Nach der Behandlung seiner Krebserkrankung begann Dirk Rohde alias Don auf Facebook seine Erlebnisse niederzuschreiben. Was erst als persönliche Verarbeitung für sich und sein Umfeld startete, entwickelte sich schnell zu einem gefragten Krebsblog. Mittlerweile gilt der Motorradpolizist als geheilt, sitzt beruflich wieder fest im Sattel. Nebenbei widmet er den Großteil seiner Freizeit der ehrenamtlichen Patientenbetreuung für das Kopf-Hals-M.U.N.D.-Netzwerk, ist isPO-Onkolotse, leitet eine Selbsthilfegruppe in Köln und engagiert sich in der Kinderkrebshilfe. Wir haben nachgefragt, warum er Krebspatienten so gut helfen kann.
Herr Rohde, Sie hatten selbst Krebs und sind nun für andere Krebspatienten da. Was können Sie diesen Menschen geben?
„Als Betroffener ist das Gespräch mit anderen Betroffenen ein Gespräch auf Augenhöhe. Ich kenne selbst die Auswirkungen von Chemo- und Strahlentherapie. Denn ich hatte einen Kopf-Hals-Mund-Tumor, genauer einen Tumor am Zungengrund. Die Therapie von malignen Tumoren im Mund und Rachen ist sehr schmerzhaft und wird von teils heftigen Nebenwirkungen begleitet. Deshalb kann ich Tipps zu vielen Hilfsmitteln geben oder zu der Frage, wie ernähre ich mich.“
Sie sind beispielsweise als Patientenbetreuer oder Onkoloste unterwegs. Wie kommt der Kontakt zwischen Ihnen und den Krebspatienten zu Stande?
„Ich gehe nie von mir aus auf Patienten zu. Die Tür muss offen sein. Oft sind es die Patienten oder Angehörige selbst, die sich an mich wenden. Das geschieht über Facebook oder über eine der Organisationen, denen ich angehöre.“
Sie haben selbst keine medizinische oder psychologische Ausbildung. Wie können Sie für Krebspatienten da sein?
„Zum einen setze ich das durch die selbst gemachte Erfahrung um, zum anderen habe ich aber auch eine Schulung als isPO Onkolotse absolviert und bin hier zertifiziert. Die Gespräche mache ich einfach mit Empathie, manchmal höre ich auch einfach nur zu. Aber grundsätzlich ist eine Säule, nach der ich arbeite, die Psycho-Onkologie und da bin ich im Bereich der Peer-to-Peer-Beratung unterwegs. Das ist die Beratung von Betroffenen mit gleichgelagerter Erkrankung. Ich kann Tipps geben, beispielsweise zur Ernährung. Dass die Betroffenen mit jemandem reden können, der das überlebt hat, das hat eine positive Auswirkung auf die Krebspatienten. Und wenn diese positiv eingestellt sind, hilft ihnen das, besser durch die Behandlung durchzukommen und die Absprachen mit den Ärzten besser umzusetzen.“
Sie gelten heute als geheilt. Ist es für Sie nicht psychisch sehr belastend, sich immer wieder mit dem Thema Krebs auseinanderzusetzen?
„Viele Betroffene wollen tatsächlich die Krankheit einfach hinter sich lassen und lehnen es ab, sich weiter damit zu beschäftigen. Ich habe mich dagegen entschieden. Wenn ich merke, dass ich seelisch abbaue, suche ich für eine Zeit lang den Abstand. Es gibt aber auch viele Erlebnisse aus denen ich wieder Kraft ziehe. Einmal wurde ich zu einem Patienten gerufen, der nach einer Operation eine für ihn induzierte Strahlentherapie ablehnte. Hierdurch war in seinem Fall die Gefahr, dass der Krebs zurückkehrt, sehr hoch. Ich führte ein intensives Gespräch mit dem Patienten und erzählte ihm von meinem eigenen Weg und dass ich heute ein Leben mit Lebensqualität führe. Ich klärte ihn auf und informierte ihn, nahm mir auch Zeit für seine Fragen. Im Ergebnis bot er mir am Ende des Gesprächs das „Du“ an und willigte in die dringend notwendige Behandlung ein. Heute gilt auch er als geheilt. Ihm geht es gut und einmal im Monat kommt er zu mir in die Selbsthilfegruppe. Als Selbstbetroffener war ich für ihn authentisch und drang zu ihm durch.“
Wann kommen Betroffene in der Regel in eine Selbsthilfegruppe?
„In eine Selbsthilfegruppe kommen Krebspatienten in der Regel erst nach Abschluss der Behandlung. Sie können auch psychoonkologische Hilfe und Gesprächstherapien in Anspruch nehmen. Die psychische Belastung kommt oft erst nach der Krebsbehandlung. Während der Behandlung entwickeln viele einen Tunnelblick und sind darauf fokussiert die Behandlung durchzuhalten. Ich selbst hätte während meiner Behandlung keine Hilfe von außen annehmen können. Nach der Behandlung kommt oft ein seelisches Tief und das Warten beginnt, ob der Krebs hoffentlich nicht erneut zurückkehrt.“
Sie engagieren sich außerdem in der Kinderkrebshilfe. Was können Sie den kleinen Patienten geben?
„Über meinen Blog fragen mich oft Eltern von krebskranken Kindern, ob ich diese nicht in meiner Polizeiuniform besuchen könnte. Das finden die Kinder natürlich toll. Oft habe ich auch einen kleinen Polizeiteddy mit dabei. Ich schenke den Kindern unbeschwerte Momente. Manchmal lade ich auch krebskranke Kinder zu mir auf die Polizeiwache ein und erkläre ihnen ein wenig das Polizeimotorrad und einen Streifenwagen. Ich habe sie auch schon einen kleinen „Fall“ lösen lassen.“
Herr Rohde, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin alles Gute für Sie und Ihre Arbeit.
Lesen Sie hier, wie Dirk Rohde zum Krebsblogger wurde.
Titelfoto: Nana – recover your smile
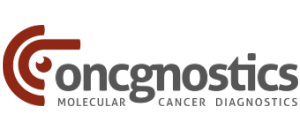
 Dirk Rohde
Dirk Rohde  GoodStudio/Shutterstock.com
GoodStudio/Shutterstock.com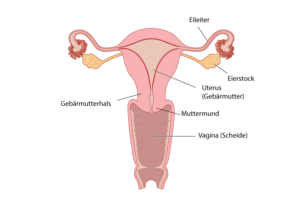
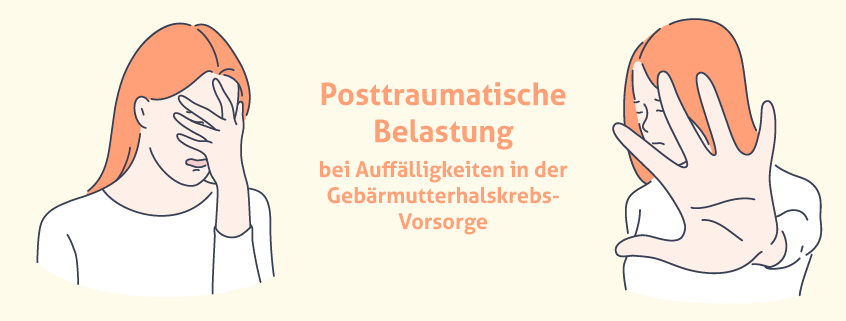
 oncgnostics GmbH/Claudia Braunstein
oncgnostics GmbH/Claudia Braunstein