https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/11/Rote-Rüben-Sulz_blog_oncgnostics..jpg
321
845
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-11-04 07:51:252020-11-23 11:07:01Köstliches Rezept bei Schluckstörungen: Rote Bete
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/09/DSC2499_Druck3_resized_20200713_121204179_blog.jpg
936
2464
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-10-30 12:04:452020-10-30 13:31:10Krebspatienten hilft das Gespräch auf Augenhöhe
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/10/202010_Blog_Gebärmutter_oncgnostics.jpg
321
845
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-10-13 10:00:352020-10-16 10:07:54Die Gebärmutter – ein komplexes Organ
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/09/Grafil_Blog-Weltttag_seelische_Gesundheit.png
321
846
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-10-05 11:35:182020-10-09 12:04:23Zum Welttag der seelischen Gesundheit
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/09/Kürbiskuchen_Claudia-Braunstein.jpg
1126
1600
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-10-05 09:01:072020-11-10 09:00:02Naschen mit Schluckstörung – Kürbiskuchen
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/09/shutterstock_398680732_web.jpg
563
845
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-09-30 08:53:062021-07-07 14:57:33Familienplanung: Wenn die Angst vor Krebs dazwischenfunkt
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/09/202009_Blog_Dirk_Rohde_Titel2.jpg
321
845
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-09-11 10:48:472020-09-22 09:45:44Schockdiagnose Krebs: Plötzlich Krebsblogger
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/01/190329_1814Low.jpg
667
1000
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-09-07 10:24:102020-09-14 08:27:50Sepsis: Symptome und Ursachen
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/09/202009_Rezept_Pflaume.jpg
321
845
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-09-02 09:56:352020-09-02 14:19:38Zwetschgen trotz Schluckstörung genießen
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/03/shutterstock_639110809_web.jpg
1280
1920
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-08-15 09:02:402020-08-28 14:15:52Was ist ein Kopf-Hals-Tumor?
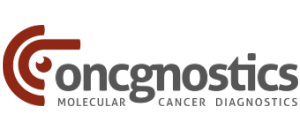
Köstliches Rezept bei Schluckstörungen: Rote Bete
BlogDiesen Monat verrät uns Foodbloggerin Claudia Braunstein, wie Menschen mit Schluckstörung Rote Bete genießen können – oder Rote Rüben, wie die Österreicherin zur leckeren Wurzel sagt. Schluckstörungen, auch Dysphagie genannt, entstehen beispielsweise durch Tumorerkrankungen im Kopf-Hals-Bereich.
Liebe Leser,
Sie sehen, ich komme aus Österreich. Da tragen viele Lebensmittel und Speisen andere Namen. Rote Rüben kennt man jenseits der Grenze als Rote Bete. Bei uns sagt man an manchen Orten auch Rohnen oder Randen. Je nachdem wo man sich gerade befindet. Oberskren? Das ist auch so ein Beispiel. Kren, das ist schlicht Meerrettich mit Sahne. Und Sulz? Das wäre hochdeutsch Sülze oder Aspik. Ja, ich finde es immer wieder spannend, wie verschieden die Bezeichnungen sind.
Übrigens: ich habe Rote Rüben als Kind gehasst. Auch noch als Jugendliche konnte man mich damit um die Häuser jagen. Das lag wohl daran, dass damals diese Rüben vorwiegend aus dem Glas oder der Dose kamen.
Das hat sich sehr verändert. Heute mag ich das violette Gemüse sehr gerne und gerade bei Schluckstörungen/Dysphagie kann man Rote Rüben vielfältig einsetzen. Suppen, Smoothies oder auch Hummus lassen sich schnell daraus zubereiten. Ich kaufe gerne vorgekochte Rüben am Bauernmarkt. Da erspart man sich viel Herumpatzerei, denn Rüben färben häufig ab.
Rote Rüben oder Rote Bete lassen sich sehr gut mit Oberskren/Meerrettichsahne kombinieren. Ein wunderbares Geschmackserlebnis. Darum habe ich ein feines Rezept für Sulz/Aspik mitgebracht. Das kann man ganz einfach zubereiten, vor allem wenn man gekochte Rüben und fertigen Oberskren verwendet.
Rezept: Rote Rüben Sulz
Rote Rüben/Rote Bete in Würfel schneiden und in einem Topf mit der Gemüsebrühe weichkochen. Mit einem Mixstab sehr fein pürieren. Mit den Gewürzen abschmecken. Gelatine nach Anleitung anrichten und unter die Masse rühren. In kleine Gläser füllen und kaltstellen.
Wenn die Masse fest ist mit Oberskren/Sahnemeerrettich garnieren.
Wenn man Oberskren/Sahnemeerrettich selbst herstellen möchte, dann schlägt man Obers/Sahne fest auf und mischt ein wenig frisch geriebenen Kren/Meerrettich darunter. Mit etwas Zitrone abschmecken.
Ihre Claudia Braunstein!
Foto: Claudia Braunstein
————————————————————–
Wir von der oncgnostics GmbH forschen an der Diagnostik von unterschiedlichen Krebsarten, so auch im Bereich der Kopf-Hals-Tumoren. Mit Betroffenen, wie Claudia Braunstein im Austausch zu stehen ist uns ein wichtiges Anliegen. So lernen wir die Besonderheiten und Bedürfnisse der Menschen kennen.
Alle Gast-Rezepte von Claudia Braunstein finden Sie hier.
Krebspatienten hilft das Gespräch auf Augenhöhe
BlogNach der Behandlung seiner Krebserkrankung begann Dirk Rohde alias Don auf Facebook seine Erlebnisse niederzuschreiben. Was erst als persönliche Verarbeitung für sich und sein Umfeld startete, entwickelte sich schnell zu einem gefragten Krebsblog. Mittlerweile gilt der Motorradpolizist als geheilt, sitzt beruflich wieder fest im Sattel. Nebenbei widmet er den Großteil seiner Freizeit der ehrenamtlichen Patientenbetreuung für das Kopf-Hals-M.U.N.D.-Netzwerk, ist isPO-Onkolotse, leitet eine Selbsthilfegruppe in Köln und engagiert sich in der Kinderkrebshilfe. Wir haben nachgefragt, warum er Krebspatienten so gut helfen kann.
Herr Rohde, Sie hatten selbst Krebs und sind nun für andere Krebspatienten da. Was können Sie diesen Menschen geben?
„Als Betroffener ist das Gespräch mit anderen Betroffenen ein Gespräch auf Augenhöhe. Ich kenne selbst die Auswirkungen von Chemo- und Strahlentherapie. Denn ich hatte einen Kopf-Hals-Mund-Tumor, genauer einen Tumor am Zungengrund. Die Therapie von malignen Tumoren im Mund und Rachen ist sehr schmerzhaft und wird von teils heftigen Nebenwirkungen begleitet. Deshalb kann ich Tipps zu vielen Hilfsmitteln geben oder zu der Frage, wie ernähre ich mich.“
Sie sind beispielsweise als Patientenbetreuer oder Onkoloste unterwegs. Wie kommt der Kontakt zwischen Ihnen und den Krebspatienten zu Stande?
„Ich gehe nie von mir aus auf Patienten zu. Die Tür muss offen sein. Oft sind es die Patienten oder Angehörige selbst, die sich an mich wenden. Das geschieht über Facebook oder über eine der Organisationen, denen ich angehöre.“
Sie haben selbst keine medizinische oder psychologische Ausbildung. Wie können Sie für Krebspatienten da sein?
„Zum einen setze ich das durch die selbst gemachte Erfahrung um, zum anderen habe ich aber auch eine Schulung als isPO Onkolotse absolviert und bin hier zertifiziert. Die Gespräche mache ich einfach mit Empathie, manchmal höre ich auch einfach nur zu. Aber grundsätzlich ist eine Säule, nach der ich arbeite, die Psycho-Onkologie und da bin ich im Bereich der Peer-to-Peer-Beratung unterwegs. Das ist die Beratung von Betroffenen mit gleichgelagerter Erkrankung. Ich kann Tipps geben, beispielsweise zur Ernährung. Dass die Betroffenen mit jemandem reden können, der das überlebt hat, das hat eine positive Auswirkung auf die Krebspatienten. Und wenn diese positiv eingestellt sind, hilft ihnen das, besser durch die Behandlung durchzukommen und die Absprachen mit den Ärzten besser umzusetzen.“
Sie gelten heute als geheilt. Ist es für Sie nicht psychisch sehr belastend, sich immer wieder mit dem Thema Krebs auseinanderzusetzen?
„Viele Betroffene wollen tatsächlich die Krankheit einfach hinter sich lassen und lehnen es ab, sich weiter damit zu beschäftigen. Ich habe mich dagegen entschieden. Wenn ich merke, dass ich seelisch abbaue, suche ich für eine Zeit lang den Abstand. Es gibt aber auch viele Erlebnisse aus denen ich wieder Kraft ziehe. Einmal wurde ich zu einem Patienten gerufen, der nach einer Operation eine für ihn induzierte Strahlentherapie ablehnte. Hierdurch war in seinem Fall die Gefahr, dass der Krebs zurückkehrt, sehr hoch. Ich führte ein intensives Gespräch mit dem Patienten und erzählte ihm von meinem eigenen Weg und dass ich heute ein Leben mit Lebensqualität führe. Ich klärte ihn auf und informierte ihn, nahm mir auch Zeit für seine Fragen. Im Ergebnis bot er mir am Ende des Gesprächs das „Du“ an und willigte in die dringend notwendige Behandlung ein. Heute gilt auch er als geheilt. Ihm geht es gut und einmal im Monat kommt er zu mir in die Selbsthilfegruppe. Als Selbstbetroffener war ich für ihn authentisch und drang zu ihm durch.“
Wann kommen Betroffene in der Regel in eine Selbsthilfegruppe?
„In eine Selbsthilfegruppe kommen Krebspatienten in der Regel erst nach Abschluss der Behandlung. Sie können auch psychoonkologische Hilfe und Gesprächstherapien in Anspruch nehmen. Die psychische Belastung kommt oft erst nach der Krebsbehandlung. Während der Behandlung entwickeln viele einen Tunnelblick und sind darauf fokussiert die Behandlung durchzuhalten. Ich selbst hätte während meiner Behandlung keine Hilfe von außen annehmen können. Nach der Behandlung kommt oft ein seelisches Tief und das Warten beginnt, ob der Krebs hoffentlich nicht erneut zurückkehrt.“
Sie engagieren sich außerdem in der Kinderkrebshilfe. Was können Sie den kleinen Patienten geben?
„Über meinen Blog fragen mich oft Eltern von krebskranken Kindern, ob ich diese nicht in meiner Polizeiuniform besuchen könnte. Das finden die Kinder natürlich toll. Oft habe ich auch einen kleinen Polizeiteddy mit dabei. Ich schenke den Kindern unbeschwerte Momente. Manchmal lade ich auch krebskranke Kinder zu mir auf die Polizeiwache ein und erkläre ihnen ein wenig das Polizeimotorrad und einen Streifenwagen. Ich habe sie auch schon einen kleinen „Fall“ lösen lassen.“
Herr Rohde, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin alles Gute für Sie und Ihre Arbeit.
Lesen Sie hier, wie Dirk Rohde zum Krebsblogger wurde.
Titelfoto: Nana – recover your smile
Die Gebärmutter – ein komplexes Organ
BlogNahezu die Hälfte der Menschheit besitzt dieses Organ, jeder Mensch startet sein Leben darin: Die Gebärmutter. Spätestens mit der ersten Menstruation wird jede Frau ihrer eigenen Gebärmutter gewahr. Doch wie sieht das weibliche Geschlechtsorgan eigentlich genau aus und welche Funktionen erfüllt es?
Die Gebärmutter, auch Uterus genannt, zählt zu den inneren weiblichen Geschlechtsorgangen. Sie besteht aus Muskeln, deren Form an eine umgedrehte hohle Birne erinnert und befindet sich leicht oberhalb des Schambeins. Bei einer erwachsenen Frau ist der Uterus 7-10 cm groß und 50-60 g schwer. Er wird durch die Muskulatur des Beckenbodens gestützt.
Die Gebärmutter besteht aus zwei Abschnitten
Gebärmutter
Der obere, dickere Abschnitt der Gebärmutter wird als Gebärmutterkörper (Corpus Uteri) bezeichnet, während der untere, schmalere Teil den Gebärmutterhals (Zervix) bildet.
Im oberen Teil des Gebärmutterkörpers münden zu beiden Seiten die Eileiter. Diese transportieren die reife Eizelle in die Gebärmutterhöhle. Dort kann sich eine befruchtete Eizelle einnisten und sich zu einem Embryo, bzw. Baby entwickeln. Dazu ist allerdings eine gut aufgebaute Gebärmutterschleimhaut (Endometrium) notwendig. Hormonell bedingt baut sich die Gebärmutterschleimhaut zyklisch auf. Liegt keine Schwangerschaft vor, wird sie wieder abgestoßen und es kommt zur Regelblutung.
Die Verbindung zwischen Gebärmutter und der Vagina ist der Gebärmutterhals. Während der Zervixkanal in der Gebärmutter mündet, ragt der äußere Muttermund in die Scheide hinein.
Die Gebärmutter während der Schwangerschaft
Wächst ein Kind in der Gebärmutter heran, leistet das Organ Erstaunliches. Der Uterus wächst, dehnt und verdickt sich, damit in ihm das größer werdende Baby, der Mutterkuchen und Fruchtwasser Platz finden. Während einer Schwangerschaft kann allein die Gebärmutter etwa ein Kilo wiegen. Unter der Geburt ziehen sich die Muskeln der Gebärmutter zusammen, unterschiedliche Wehen helfen schließlich dabei, das Kind auszutreiben.
Erkrankungen des Uterus
Bei einem schwachen Beckenboden kann es zu einer Gebärmuttersenkung kommen. Auch können sich gutartige Knoten in der Muskulatur des Uterus, sogenannte Myome bilden. Eine sehr häufige Frauenkrankheit ist die Endometriose. Dabei lagert sich Gebärmutterschleimhaut außerhalb des Organs ab, was für die Frauen sehr schmerzhaft sein kann und häufig auch eine Ursache für unerfüllten Kinderwunsch darstellt.
Gebärmutterkrebs betrifft den Gebärmutterkörper und tritt meist hormonell bedingt, manchmal aber auch durch erbliche Veranlagung auf. Ungewöhnliche Blutungen können einen Hinweis auf eine Krebserkrankung sein und sollten abgeklärt werden.
Infiziert sich eine Frau beispielsweise beim Geschlechtsverkehr mit HPV (Humanen Papillomviren), bemerkt sie in der Regel davon nichts. In den meisten Fällen heilt die HPV-Infektion von allein aus. Selten jedoch hält die Infektion an und verändert das Gewebe am Gebärmutterhals. Auch diese Veränderungen (Dysplasien) können sich wieder zurückbilden – es können sich jedoch auch Krebsvorstufen bis hin zu Gebärmutterhalskrebs entwickeln. Aus diesem Grund ist es wichtig, regelmäßig zur Krebsvorsorge beim Frauenarzt zu gehen, um Gebärmutterhalskrebs früh, möglichst bereits in seinen Vorstufen zu entdecken.
——————————–
Titelbild: GoodStudio/Shutterstock.com
Zum Welttag der seelischen Gesundheit
PressemeldungAuffällige Befunde in der Gebärmutterhalskrebs-Vorsorge können Anzeichen einer Posttraumatischen Belastungsstörung auslösen. Darauf macht die oncgnostics GmbH am jährlich stattfindenden Welttag der seelischen Gesundheit am 10. Oktober aufmerksam und zeigt dabei auf: auffällige Pap-Test-Befunde und/oder positive HPV-Tests wirken belastend auf die Psyche der betroffenen Frauen. Das Unternehmen, das auf die Diagnostik von Krebs spezialisiert ist, bezieht sich dabei auf eine aktuelle Studie [1].
In der Studie wurden 3.753 Frauen online befragt. Davon trat bei etwa der Hälfte der Frauen mindestens ein auffälliger Befund im Rahmen der Gebärmutterhalskrebs-Vorsorge auf. Mehr als die Hälfte der betroffenen Frauen litten mehr als ein Jahr unter wiederkehrenden Auffälligkeiten. Die Belastung über diesen langen Zeitraum hat Auswirkungen auf die psychische Verfassung der Betroffenen. So zeigten in der Befragung 28 Prozent der betroffenen Frauen Anzeichen einer Posttraumatischen Belastungsstörung.
Welttag der psychischen Gesundheit schafft Aufmerksamkeit
Bereits 1992 wurde der Welttag der seelischen Gesundheit von der World Federation for Mental Health (WFMH) ins Leben gerufen. Dieser soll Aufmerksamkeit für die Anliegen der psychischen Gesundheit und die Bedürfnisse psychisch erkrankter Menschen schaffen. Während körperliche Leiden in der Gesellschaft meist anerkannt sind und auf externe Ursachen zurückgeführt werden, ist auch heute noch die Meinung weit verbreitet, dass psychische Erkrankungen selbst verschuldet seien.
oncgnostics GmbH weist auf psychische Belastung hin
Mit der im Juli veröffentlichten Studie weisen die oncgnostics-Geschäftsführer Dr. Alfred Hansel und Dr. Martina Schmitz als Co-Autoren auf die aktuelle Situation in der Gebärmutterhalskrebs-Vorsorge hin, wie in der unten stehenden Pressemitteilung näher erläutert wird.
——————————————————–
[1] Jentschke et al. (2020): Psychological distress in cervical cancer screening: results from a German online survey, in: Archives of Gynecology and Obstetrics 302:699–705.
Pressemitteilung
Auffällige Befunde in der Gebämutterhalskrebs-Vorsorge
können Anzeichen Postrraumatischer Belastungsstörung auslösen
Welttag der seelischen Gesundheit
Naschen mit Schluckstörung – Kürbiskuchen
BlogSchluckstörungen, auch Dysphagie genannt, können Betroffenen den Genuss beim Essen vermiesen. Sie entstehen unter anderem durch Tumorerkrankungen im Kopf-Hals-Bereich. Die österreichische Foodbloggerin Claudia Braunstein kennt das Problem aus eigener Erfahrung und teilt auf ihrem Blog köstliche Rezepte. Heute verrät sie uns ihr Kürbiskuchen-Rezept:
Liebe Leserinnen und Leser,
Kuchen sind für Menschen, die an Dysphagie/Schluckstörungen leiden, ein besonders heikles Thema. Vor allem, wenn der Grund eine Tumorerkrankung im Mund war und durch die Entfernung von Gewebeteilen, in meinem Fall ein Teil der Zunge, eine funktionelle Einschränkung besteht. Da ist es oft sehr schwierig, trockene und bröselige Speisen zu schlucken. Wenn ich unterwegs bin, helfe ich mir, indem ich feste Teigböden einfach meiner Begleitung überlasse und nur die weiche Füllung esse.
Kürbiskuchen auch mit Schluckstörung ein Genuss
Ich mag Kürbis in allen Variationen, früher gerne auch den bekannten Pumpkin Pie, der ja einen Mürbteigboden hat. Das geht leider gar nicht. Wenn man die Füllmasse etwas modifiziert, dann lässt sich ganz einfach ein Kürbiskuchen ohne Boden herstellen. Natürlich lässt sich die Kürbis-Topfen-Masse auch mit Teigboden backen.
Wir ÖstereicherInnen sagen zu Quark übrigens Topfen.
Rezept: Kürbiskuchen ohne Boden
Den Springform-Boden mit einem Backpapier-Kreis auslegen und den Rand mit Butter einfetten. Dann den Backofen mit Ober/Unterhitze auf 170 Grad vorwärmen.
Den Kürbis halbieren, die Kerne entfernen, schälen und in Würfel schneiden. Anschließend die Kürbiswürfel in einen Topf geben, mit Wasser bedecken und weichkochen. Das Wasser abgießen und den Kürbis fein pürieren, danach zur Seite stellen und auskühlen lassen.
Die Eier trennen und das Eiweiß steif schlagen. In einer anderen Schüssel alle weiteren Zutaten aufschlagen. Erst dann das steife Eiweiß unterheben. Die Masse in die Springform füllen und bei 170 Grad ca. 90 Minuten backen. Auskühlen lassen und am besten über Nacht in den Kühlschrank stellen.
Ihre Claudia Braunstein!
————————————————————–
Wir von der oncgnostics GmbH forschen an der Diagnostik von unterschiedlichen Krebsarten, so auch im Bereich der Kopf-Hals-Tumoren. Mit Betroffenen, wie Claudia Braunstein im Austausch zu stehen ist uns ein wichtiges Anliegen. So lernen wir die Besonderheiten und Bedürfnisse der Menschen kennen.
Alle Gast-Rezepte von Claudia Braunstein finden Sie hier.
Familienplanung: Wenn die Angst vor Krebs dazwischenfunkt
BlogErfahrungsberichte von Frauen in der Familienplanung, bei denen in der Krebsvorsorge ein auffälliger Befund gestellt wurde, sind häufig von Unsicherheit und Frust geprägt. Nach einem gemeinsamen Aufruf mit der Anti-Krebs-Aktivistin Myriam von M. erzählten uns viele Frauen ihre Geschichte. Einige erlebten nach einer durchgeführten Konisation Risikoschwangerschaften oder sogar Fehlgeburten. Sie berichteten von Schuldgefühlen und der Angst vor einer erneuten Schwangerschaft, obwohl sie gern ein (weiteres) Kind bekommen würden.
Auffälliger Befund: Auswirkungen auf die Familienplanung
Treten Auffälligkeiten in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge auf, wie beispielsweise ein auffälliger Pap-Befund oder ein positiver HPV-Test, kann dies zu psychologischen Belastungen führen. Dies zeigt eine neue Studie [1], für die 3.753 Frauen befragt wurden.
Die Unsicherheit der Frauen ist unter anderem auf die Methode des „Kontrollierten Zuwartens“ zurückzuführen. Festgestellte Auffälligkeiten am Gewebe heilen häufig von alleine wieder aus. Daher werden sie oft über einen langen Zeitraum mit wiederholten Tests beobachtet. Bei Frauen, die noch nicht mit der Familienplanung abgeschlossen haben, kann sich so das Gefühl einstellen, dass ihnen wertvolle Zeit verloren geht. Auch das Wissen darum, dass sich Gebärmutterhalskrebs über viele Jahre entwickelt, kann die Frauen mit Kinderwunsch unter Zeitdruck setzen. So kann es sein, dass die Frau so schnell wie möglich schwanger werden möchte, bevor der vermeintlich schlechte Befund des Gebärmutterhalsabstriches noch weiter fortschreitet.
Gibt es einen Zusammenhang von Konisation und Frühgeburt?
Bleiben die Untersuchungsergebnisse auffällig oder verschlechtert sich der Befund, verdichten sich somit die Anzeichen für eine Krebserkrankung. In dem Fall kann vom Arzt eine Konisation empfohlen und durchgeführt werden. Dabei wird der Gebärmutterhals kegelförmig ausgeschnitten [2].
Es ist umstritten, ob es einen direkten Zusammenhang zwischen einem solchen Eingriff und späteren Frühgeburten gibt. Verschiedene wissenschaftliche Studien legen jedoch nahe, dass das Risiko für eine Frühgeburt nach einer durchgeführten Konisation zunimmt.
Beispielsweise zeigen Studienergebnisse von 2010 [3]:
Entsprechend nachvollziehbar ist es, dass betroffene Frauen beunruhigt sind, wenn sie eine erste oder weitere Schwangerschaft planen.
Anzeichen von Gebärmutterhalskrebs: Schwangerschaft nicht unmöglich
An dieser Stelle ist es wichtig festzuhalten, dass Auffälligkeiten in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge dem geplanten Familienzuwachs nicht grundsätzlich im Weg stehen. Hier gilt es, die Anzeichen genau zu deuten. Eine Infektion mit Humane Papillomaviren (HPV) kann Krebs auslösen, das muss jedoch nicht geschehen. Ein Großteil der Frauen hat in ihrem Leben eine HPV-Infektion, die meist völlig unbemerkt von allein wieder ausheilt. Ein zusätzlicher auffälliger Pap-Befund kann sich zudem nicht nur verschlechtern, sondern auch verbessern. Nur selten entsteht wirklich Krebs. Gebärmutterhalskrebs entsteht über verschiedene Vorstufen. Er kann bereits in einem frühen Stadium entdeckt werden. In diesem Fall ist die Krebserkrankung fast immer heilbar. Die Gebärmutter selbst bleibt erhalten und nimmt keinen Schaden.
Deutlich wird, dass regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt während der Familienplanung bereits vor einer Schwangerschaft dazugehören. Bei auffälligen Pap-Befunden oder HPV-Infektionen können molekularbiologische Verfahren dabei unterstützen, herauszufinden, ob diese Auffälligkeiten tatsächlich auf eine zu behandelnde Krebsvorstufe oder bestehende Krebserkrankung zurückzuführen sind. Die Zeit der engmaschigen Kontrolle beim Frauenarzt kann somit deutlich verkürzt und klare Vorgehensweisen schnell beschlossen werden. Auch können so im Einzelfall operative Eingriffe wie eine Konisation verhindert werden.
Quellen
[1] Jentschke et al. (2020): Psychological distress in cervical cancer screening: results from a German online survey, in: Archives of Gynecology and Obstetrics 302:699–705.
[2] https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/leben-mit-krebs/kinderwunsch-und-krebs/erhalt-der-fruchtbarkeit.html
[3] Ørtoft et al. (2010): After conisation of the cervix, the perinatal mortality as a result of preterm delivery increases in subsequent pregnancy, in: BJOG 117:258–267.
Titelfoto: Africa Studio/Shutterstock.com
Schockdiagnose Krebs: Plötzlich Krebsblogger
BlogVon einem Moment auf den anderen wurde aus dem aktiven, leidenschaftlichen Polizisten Dirk Rohde ein Krebspatient, der um sein Leben kämpft. Inzwischen hat er diesen Kampf gewonnen und eine neue Leidenschaft entdeckt. Mit Leib und Seele ist der Krebsblogger alias Don nun für andere Krebspatienten da. Doch wie entwickelt sich aus einem persönlichen Schock so eine produktive Energie? Wir haben nachgefragt.
Herr Rohde, Ihr Blog auf Facebook heißt „Schockdiagnose Krebs. Plötzlich ist alles anders.“, auf Instagram sind sie als don.ro unterwegs. War es für Sie nach ihrer Diagnose sofort klar, dass Sie Ihr Erlebtes mit der Öffentlichkeit teilen wollen?
„Die Krebsdiagnose war für mich tatsächlich ein Schock. Ich bin mit einer Delle am Hals zum Arzt, der Verdacht einer Zyste stand im Raum. Dann stellte sich plötzlich heraus, dass ich einen Kopf-Hals-Mund-Tumor, genauer einen Tumor am Zungengrund habe. Das bedeutet: sehr komplizierte Operationen, begleitet von Strahlen- und Chemotherapie. Meine Prognose war zunächst nicht sehr gut. Die Therapie war für mich sehr qualvoll. Für die Behandlung habe ich einen Tunnelblick entwickelt. In dieser Situation hätte ich selbst kaum Hilfe annehmen, geschweige denn einen Blog schreiben können. Nach so einer Behandlung sind viele Patienten seelisch angeschlagen. Ich hatte das Bedürfnis, mir das Erlebte von der Seele zu schreiben. Damit habe ich erst Monate danach angefangen. Erst war der Blog nur für mich und Freunde gedacht, um das Erlebte zu verarbeiten. Dass ich damit so eine öffentliche Wirkung erzielen würde und Krebsblogger werden würde, war überhaupt nicht beabsichtigt.“
Sie haben aktuell rund 18 000 Abonnenten auf Facebook – Tendenz steigend. Wie fanden die alle zu Ihnen?
„Als ich in der akuten Situation war, hatte ich niemanden, mit dem ich über die Krankheit reden konnte. Ich habe gegoogelt, aber irgendwann war ich es leid nur noch zu lesen, wie schlecht meine Aussichten sind. Mein Blog ist da anders. Ich war vor der Krebserkrankung Polizist und habe den Wiedereinstieg in den Beruf geschafft. Ich bin wieder als Motorradpolizist unterwegs. Das zeige ich auf meinem Blog. Hoffnung ist ein ganz wichtiger Bestandteil, denn ich bin ein Betroffener, der als geheilt gilt.“
Sie stehen wieder fest im Berufsleben. Nebenbei engagieren Sie sich ehrenamtlich stark für Krebspatienten, beispielsweise leiten sie eine Krebsselbsthilfegruppe in Köln. Wie kam das?
„Das baute sich alles langsam über Monate auf. Ich hatte mich beim Patientennetzwerk Kopf-Hals-M.U.N.D.-Krebs e.V. angemeldet. Dann wurde ich gefragt, ob ich nicht eine Selbsthilfegruppe in Köln gründen wolle. Ich wusste noch gar nicht, wie man eine Gruppe führt und sagte trotzdem zu. Außerdem erreichen mich über meinen Blog immer wieder Anfragen von Krebspatienten oder deren Angehörige. Mittlerweile bin ich ehrenamtlich Patientenbetreuer, isPO -Onkolotse, leite eine Selbsthilfegruppe und engagiere mich in der Kinderkrebshilfe.“
Herr Rohde, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit!
Fotos: privat: Dirk Rohde
Sepsis: Symptome und Ursachen
BlogUmgangssprachlich wird eine Sepsis auch als Blutvergiftung bezeichnet. Dabei handelt es sich um eine Infektion, die den ganzen Körper betrifft. Das Gefährliche daran: Im Kampf gegen die Infektion greift das Immunsystem auch körpereigene Organe an. Die schlimmste Folge kann ein lebensbedrohliches Multiorganversagen sein. Umso wichtiger ist es, die Ursachen und Symptome einer Sepsis zu kennen.
Eine Sepsis ist nicht immer leicht zu diagnostizieren. Jährlich treten in Deutschland rund 280 000 Sepsisfälle auf. Rund ein Drittel enden tödlich. Bei einer Infektion gelingt es dem Immunsystem normalerweise den Entzündungsherd örtlich zu begrenzen. Tritt eine Sepsis auf, konnten die Erreger die lokale Begrenzung allerdings durchbrechen und breiten sich im gesamten Blutkreislauf aus.
Sepsis: Ursachen einer Sepsis
Grundsätzlich kann jede Infektion, ob mit Bakterien, Viren oder Pilzen, eine Blutvergiftung auslösen. Wenn die Krankheitserreger eines lokal begrenzten Infektionsherds in den gesamten Blutkreislauf gelangen, entsteht eine Sepsis. Entgegen der weit verbreiteten Meinung muss diese nicht durch eine äußere, sichtbare und infizierte Wunde entstehen. Infektionen wie eine Lungenentzündung oder ein entzündeter Zahn können ebenso zu einer Sepsis führen, wie offene Wunden durch Verletzungen. Eine Sepsis kann jedoch auch die Folge einer Komplikation nach einem chirurgischen Eingriff sein.
Symptome einer Sepsis
Tritt eine Sepsis auf, zählt oft jede Minute. Leider ist es jedoch nicht immer einfach, diese zu erkennen. Sehr hohes Fieber, Schüttelfrost, aber auch Untertemperatur können auf eine Sepsis hindeuten. Auch Herzrasen oder eine beschleunigte Atmung können Symptome einer Blutvergiftung sein. Oft ähneln die Symptome einem normalen grippalen Infekt, bis sich der Zustand des Patienten schlagartig verschlechtert. Betroffene sollten unverzüglich ein Krankenhaus aufsuchen. Für Ärzte ist es nicht sofort vorher zu sehen, ob sich aus einer scheinbar harmlosen Infektion eine lebensbedrohliche Sepsis entwickeln wird.
Das Immunsystem spielt eine große Rolle
Besonders gefährdet sind Menschen mit einem geschwächten Immunsystem. Das Risiko für eine Blutvergiftung steigt beispielsweise bei der Einnahme bestimmter Medikamente, Diabetes mellitus, einer Krebserkrankung oder nach einer Operation. Es besteht allerdings auch eine Annahme, dass manche Menschen durch eine Sepsis eine unvorhersehbare Immunschwäche ausbilden und somit für lebensbedrohliche Folgeinfektionen anfällig sind. Aus diesem Grund forschen wir als Teil eines EU-Konsortiums Diagnosemöglichkeiten, um herauszufinden, welche Patienten besonders gefährdet sind, eine solche Immunschwäche auszubilden.
Zwetschgen trotz Schluckstörung genießen
BlogAuch diesen Monat verrät uns die österreichische Foodbloggerin Claudia Braunstein wieder eines ihrer tollen Rezepte. Das Besondere daran: Ihre Rezepte eignen sich hervorragend für Menschen mit Schluckstörung! Heute erzählt uns Claudia Braunstein, wie sie Zwetschgen trotz Schluckstörung genießt.
Gastbeitrag von Claudia Braunstein:
Lieber Leserinnen und Leser,
Powidl, was für ein hübsches Wort. Da kommen Erinnerungen an meine Kindheit hoch. Powidl oder auch Zwetschgen genannt, hat meine Oma im September immer eingekocht. Powidl benötigt man für Buchteln oder Germknödel, die vermutlich jeder Skifahrer irgendwann einmal in einer Skihütte verkostet hat. Achja Germknödel, Hefeklöße würde man wohl nördlich von Bayern sagen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob man diese Speise überhaupt außerhalb des Alpenraumes kennt.
Und dann noch die beliebten Pofesen. Das sind Arme Ritter, die man mit Powidl herstellt und dann nicht zu vergessen Powidldatschgerl, die kennt man im Wiener Raum und werden aus Kartoffelteig geformt und mit dem Fruchtmus gefüllt.
Zwetschgen trotz Schluckstörung: anders kombinieren
Lauter Herrlichkeiten, die man oftmals mit Schluckstörungen, Dysphagien, nicht mehr essen kann. Meist scheitert es am Teig. Ich verzichte lieber auf das ganze Beiwerk und löffle das Mus mit einem Naturjoghurt. Oder man mischt es unter Sauerrahm oder Topfen.
Die Bezeichnung Powidl stammt aus dem Tschechischen und wir Österreicher sagen ganz gerne „das is mir powidl“, was so viel bedeutet wie „das ist mir egal“.
Ganz original benötigt man für die Herstellung nur Zwetschgen und Wasser. Für eine etwas feinere Note kann man auch Zimt, ein wenig Nelken und sogar Rosmarin verwenden. Ich habe auch schon Lavendelblüten mitverkocht.
Rezept: Zwetschgenmus
Zwetschgen waschen, halbieren, entkernen und in kleine Stücke schneiden. In einen hohen Topf geben und etwas Wasser zufügen. Bei niedriger Temperatur rund acht Stunden ziehen lassen. Immer wieder umrühren. Gegen Ende der Garzeit Zucker und eventuell Gewürze zugeben. Nochmals gut eine Stunde weitergaren lassen. Gewürze eventuell wieder entfernen. Noch heiß in Gläser füllen, gut verschießen. Gläser auf den Kopf stellen und abkühlen lassen. Das tolle an Zwetschgenmus: es ist tatsächlich über Monate, sogar Jahre haltbar.
Alle Gast-Rezepte von Claudia Braunstein finden Sie hier.
Was ist ein Kopf-Hals-Tumor?
BlogDer Begriff Kopf-Hals-Tumor ist ein Sammelbegriff für unterschiedliche Krebsarten, die im Bereich des Kopfes und des Halses auftreten. Dazu gehören der Mundhöhlenkrebs, Krebs der Nase und Nasennebenhöhlen, Tumoren im Rachen, der Mandeln und des Zungengrundes sowie Tumoren des Kehlkopfs und des äußeren Halses, insbesondere der Schilddrüse.
Wenn Kopf-Hals-Tumoren auch zu einer Gruppe zusammengefasst werden, gibt es doch zwischen den Arten wesentliche Unterschiede und medizinische Besonderheiten. Für ein besseres Verständnis sind im Folgenden die Tumorarten des Kopf-Hals-Bereiches genauer erklärt.
Mundhöhlenkrebs
Zu den Mundhöhlenkarzinomen zählen Tumoren in den Regionen der Lippe, Zunge, des Mundbodens, des harten Gaumens, der Wangenschleimhaut und Kieferkämme sowie der Speicheldrüsen. Die Mundbodenkarzinome stellen mit 45% die häufigste Tumorart in dieser Gruppe dar. Neben Alkohol- und Tabakkonsum zählt auch eine mangelhafte Mundhygiene zu den Risikofaktoren. Frühe Symptome werden häufig kaum bemerkt.
Um Mundhöhlenkrebs frühzeitig zu erkennen, sind zwei Dinge wichtig. Der regelmäßige Kontrolltermin beim Zahnarzt dient auch dazu, auffällige Veränderungen der Mundschleimhaut (Leukoplakien) festzustellen. Unabhängig davon sollte jeder selbst auf Veränderungen im Mundraum achten. Das können weißliche oder rote Flecken sein, wunde Stellen, die leicht bluten und nicht heilen, Schwellungen, ein Fremdkörpergefühl oder Schwierigkeiten beim Schlucken. Diese Beschwerden können Anzeichen einer Vorstufe von Kopf-Hals-Tumoren sein und sollten unbedingt von einem Arzt abgeklärt werden.
Über die Hälfte der Mundhöhlenkarzinome werden trotzdem weiterhin erst in fortgeschrittenen Stadien diagnostiziert, was die Chance auf Heilung deutlich senkt.
Querschnitt des Kopf-Hals-Bereichs – VectorMine/Shutterstock.com
Oropharynx: Rachen, Mandeln und Zungengrund
Diese Untergruppe der Kopf-Hals-Tumoren umfasst Tumoren der Rachenwände (Pharynxkarzinom), des Zungengrunds, der Mandeln (Tonsillenkarzinom) und des weichen Gaumens. Auch bei dieser Tumorart fehlen Frühwarnzeichen, die eine zeitige Erkennung der Erkrankung zulassen. Tumoren im Atem- und Speiseweg werden deshalb häufig in einem fortgeschrittenen Stadium bemerkt.
Risikofaktoren für ein Oropharynxkarzinom sind ebenfalls Alkohol- und Tabakkonsum. Aber auch eine Infektion mit Humanen Papillomviren (HPV) hängt stark mit einer Krebserkrankung an Rachen, Mandeln und Zungengrund zusammen. Eine HPV-Infektion kann Krebs vor allem am Zungengrund und den Mandeln verursachen. Die Raten der Erkrankungen an Oropharynxkarzinomen, die mit einer HPV-Infektion assoziiert sind, steigt gerade bei jungen Menschen mit gutem Gesundheitszustand an .
Aus diesem Grund werden Impfstoffe für die Anwendung bei Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 13 Jahren empfohlen, um einer Erkrankung an Kopf-Hals-Tumoren und Gebärmutterhalskrebs entgegenzuwirken.
Krebs am Kehlkopf und Schlundrachen
Zu dieser Gruppe zählen Schlundrachenkrebs (Hypopharynxkarzinom) und Kehlkopfkrebs (Larynxkarzinom). In dieser Region des Halses findet nicht nur die Sprach- und Stimmbildung statt, sie wird auch zum Schlucken benötigt. Wird das System beispielsweise durch eine Krebserkrankung gestört, kann den Betroffenen auch das Schlucken schwerfallen. Warnzeichen für eine Krebserkrankung am Kehlkopf und Schlundrachen sind deshalb eine langanhaltende Heiserkeit oder Schwierigkeiten beim Schlucken.
Auch hier gehören Alkohol- und Tabakkonsum zu den Risikofaktoren. Aber auch bestimmte Berufsgruppen gelten als besonders gefährdet, wenn sie beispielsweise regelmäßig mit krebserregenden Stoffen wie Metall- oder Kohlestäuben in Kontakt kommen.
Tumoren des Kehlkopfs und Schlundrachens sind schwer zugänglich, weshalb häufig eine Endoskopie zur Diagnose nötig ist. Die Therapie kann in manchen Fällen zur Veränderung der Stimmqualität führen oder eine erhöhte Heiserkeit hervorrufen. Bei einer stark fortgeschrittenen Erkrankung und großen Tumoren kann es nötig sein, den Kehlkopf vollständig zu entfernen (Laryngektomie). Mit verschiedenen Techniken wird dann alles dafür getan, die Stimme über verschiedene Techniken wiederherzustellen (z.B. über elektronischen Hilfen). Auch der Schluckmechanismus kann durch die Therapie beeinträchtigt werden.
Äußerer Hals und Schilddrüse
Diese Gruppe der Kopf-Hals-Tumoren beinhaltet den seltenen Schilddrüsenkrebs sowie maligne Erkrankungen des äußeren Halses.
Letztere Gruppe ist sehr heterogen und beinhaltet unter anderem maligne Lymphome sowie Halslymphknotenmetastasen mit unbekanntem Primärtumor (CUP-Syndrom). Die Schilddrüse produziert wichtige Hormone, die für eine allgemein normale Körperfunktion essentiell sind.
Schilddrüsenkarzinome treten bei Frauen häufiger auf als bei Männern und werden meist zufällig bei Untersuchungen der Schilddrüse entdeckt. Patienten sind in der Regel zwischen 25 und 65 Jahren alt. Schwellungen am Hals sollte man deshalb unbedingt von einem Arzt abklären lassen.
Krebs in Nase und Nasennebenhöhlen
Das Nasopharynxkarzinom oder auch Nasenrachenkrebs genannt, gehört zu den seltenen Formen der Kopf-Hals-Tumoren. Diese Form der Krebserkrankung ist vermehrt in Asien verbreitet, da neben genetischen Ursachen besonders Umwelteinflüsse zu den Risikofaktoren zählen. In Mitteleuropa ist das Risiko an einem Nasopharynxkarzinom zu erkranken etwa 40 Mal niedriger. Die Entstehung des Nasopharynxkarzinoms wird mit einer Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus (EBV) in Verbindung gebracht.
Treten Symptome wie häufiges Nasenbluten oder eine eingeschränkte Nasenatmung über einen langen Zeitraum auf, wird zur Abklärung und Diagnose eine Spiegelung oder endoskopische Untersuchung durchgeführt. Ist die Krankheit stark fortgeschritten können Hörverlust, Ohrenschmerzen, Gesichtsschwellung und Taubheitsgefühl im Gesicht die Folge sein.
1 für 3 Regel: Diese Symptome abklären lassen.
Vorsorge für Kopf-Hals-Tumoren
Für alle oben beschriebenen Erkrankungen gibt es bislang keine Vorsorge, die Patienten kommen aufgrund von Beschwerden selbst zum Arzt. Häufig treten Symptome erst im Spätstadium der Erkrankung auf. Die Heilungschancen sind dann nicht mehr besonders gut. In Kooperation mit der HNO-Klinik in Jena arbeiten wir an Biomarkern, die zur Erkennung solcher Tumore eingesetzt werden können.
Titelbild: Andrey Popov/Shutterstock.com