https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2021/11/211125_Talkshow_Myriam_Martina.png
321
845
TowerPR
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
TowerPR2021-12-15 08:06:592021-12-15 10:35:0650 Jahre Pap-Test – Eine Erfolgsgeschichte?
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2021/11/211125_HIV_Krebs_shutterstock_1541347955.jpg
321
845
TowerPR
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
TowerPR2021-12-01 08:00:182021-12-08 13:56:15HIV und Krebs: Erhöhtes Risiko bei HIV-Infektion
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2021/10/210318_Eierstockkrebs_Shutterstock_720850753.jpg
321
845
TowerPR
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
TowerPR2021-10-27 08:00:572021-10-27 08:33:26Eierstockkrebs: Die stille Gefahr
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2021/08/210825_Selbsthilfegruppe-scaled.jpg
1060
2560
TowerPR
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
TowerPR2021-10-14 06:00:382024-08-23 10:25:34Austausch in schweren Zeiten: Krebs-Selbsthilfegruppen
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2021/09/210916_carolin_dippmann_labor_quer_1.jpg
345
821
TowerPR
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
TowerPR2021-09-27 15:57:262021-09-27 15:57:26Studium und Promotion bei oncgnostics
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
0
0
Martina Schmitz
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Martina Schmitz2021-09-22 15:38:372021-09-22 15:39:11DxPx Partnering Conference Europe
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
0
0
Martina Schmitz
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Martina Schmitz2021-09-17 11:06:242021-09-17 11:06:43Deutsche Biotechnologietage 2021
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2021/09/210913_Yes_Con_2.jpg
345
821
TowerPR
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
TowerPR2021-09-16 08:00:102021-09-16 15:14:37Krebs enttabuisieren: Interview mit Jochen Kröhne (yeswecan!cer gGmbH)
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2021/01/202101_Blog_Titel_Claudia-Braunstein.jpg
321
845
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2021-09-08 15:00:202021-09-08 15:19:45Rezidivverdacht: Ich war richtig zornig
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2021/08/210804_oncgnostics_Vorsorge-Spanien-Portgual.jpg
711
1800
TowerPR
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
TowerPR2021-08-25 08:57:152021-08-25 09:43:49GynTect® in anderen Ländern: Wie sieht die Krebsvorsorge in Portugal und Spanien aus?
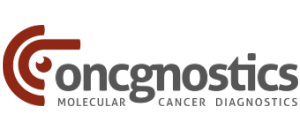
50 Jahre Pap-Test – Eine Erfolgsgeschichte?
Blog50 Jahre nachdem der Pap-Test in Deutschland systematisch in die Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs eingebunden wurde, betrifft die Krebserkrankung noch immer zu viele Frauen. Allein in Deutschland erkranken jährlich etwa 4.000 Personen. Zu ihnen gehört die Krebsaktivistin und Influencerin Myriam von M. Sie widmete sich der Krankheit ausführlich in der letzten Ausgabe ihrer Talkshow „Das halbvolle Glas“. Unsere Geschäftsführerin Dr. Martina Schmitz war als Gast dabei.
Video auf Facebook ( ab 44:20 Minuten startet der Talk):
Krebsvorsorge ist Thema von ungebrochener Relevanz
„Mich sprechen viele Frauen an, die in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge einen Pap3D1 Wert erhalten haben. Das ist so die erste Stufe, auf der man das beobachten sollte“, erzählt Myriam von M in ihrer Talkshow. Sie steht Krebspatientinnen und -patienten bereits seit 2014 mit ihrer Vorsorge- und Aufklärungskampagne FUCK CANCER zur Seite. Sie führt aus: „Die Betroffenen wissen nicht, ob sich die festgestellten Zellveränderungen zu Krebs entwickeln oder wieder ausheilen. Und ihre Ärzte sagen zunächst nur, dass sie in einem halben Jahr wiederkommen sollen. Das ist ganz schöner Psychoterror und müsste so auch gar nicht sein. Auch heute schauen uns sicher einige Frauen mit einem auffälligem Pap-Wert zu, die nicht genau wissen, was das bedeutet.“
Wir erklären, was dahintersteckt:
Pap-Test: Frauenarzt gibt Auskunft zu Auffälligkeiten
Frauen in Deutschland haben einen jährlichen Anspruch auf einen Pap-Test. Kosten entstehen Ihnen dabei keine. Für den Test werden mit einem Pap-Abstrich Zellen von Muttermund und Gebärmutterhals entnommen und später im Labor auf Zellveränderungen untersucht, die auf eine Krebserkrankung hindeuten. Insgesamt werden rund 16,5 Millionen Pap-Tests pro Jahr in Deutschland vorgenommen1.
Die Ergebnisse werden in fünf Gruppen eingeteilt: Von Pap 1 (unauffällig) über Pap3D1 (leichte Zellveränderung beim Abstrich) bis Pap 5 (Verdacht auf Gebärmutterhalskrebs). Ist ein Pap-Test positiv, also der Gruppe 3 bis 5 zuzuordnen, informiert die gynäkologische Praxis die Patientin darüber.
Zu den möglichen Anschlussuntersuchungen gehört dann u. a. ein Test auf Humane Papillomviren (HPV), da diese Viren hauptsächlich für Gebärmutterhalskrebserkrankungen verantwortlich sind. Bei Frauen ab 35 wird der HPV-Test standardmäßig gemeinsam mit dem Pap-Test angewandt. Das liegt daran, dass der HPV-Test bei jüngeren Frauen viel zu häufig positiv wäre und entsprechend abgeklärt werden müsste. Immerhin infiziert sich fast jeder von uns einmal im Leben mit dem Virus. Die meisten Infektionen werden nicht bemerkt und heilen von allein wieder aus. Gebärmutterhalskrebs selbst entsteht über Jahre hinweg und tritt in der Regel erst in einem höheren Alter auf. Wenn auch der HPV-Test positiv ausfällt, kann GynTect abklären, ob eine Krebserkrankung vorliegt.
Wir von der oncgnostics GmbH forschen und entwickeln Krebstests auf molekularbiologischer Basis. Eines unserer Produkte ist GynTect, ein Test auf Gebärmutterhalskrebs. Er ist in der Lage, Gebärmutterhalskrebs bereits in seinen Vorstufen zu erkennen. Für seine Durchführung ist ein gynäkologischer Abstrich beim Frauenarzt ausreichend.
Entwicklung der Gebärmutterhalskrebsvorsorge in den letzten 50 Jahren
Bereits 1928 entwickelte der Pathologe George Nicholas Papanicolaou den Test und gab ihm seinen Namen. Seit 1971 werden Pap-Tests standardmäßig in der Gebärmutterhalskrebsfrüherkennung in Deutschland eingesetzt.
Elf Jahre später, im Jahr 1982, entdeckte Professor Harald zur Hausen den Zusammenhang von HPV und Gebärmutterhalskrebs. Innerhalb der nächsten Jahre schuf er die Grundlagen für den HPV-Impfstoff. Dabei wurde er von unserem wissenschaftlichen Kooperationspartner Professor Dr. Matthias Dürst unterstützt.
„Die Einführung des Pap-Tests und die Erkenntnis, dass HPV die Ursache für Gebärmutterhalskrebs darstellt, haben die Wissenschaft und die Krebsfrüherkennung maßgeblich vorangebracht. So wurde 2020 die Kombinationsuntersuchung (Ko-Test) aus Pap-Test und HPV-Test für Frauen ab 35 Jahren eingeführt. Diese Neuerung erhöht die Zuverlässigkeit der Früherkennung. Allerdings ist zu bemängeln, dass es oft viele Jahre dauert, bis neue wissenschaftliche Erkenntnisse in der täglichen Praxis Einzug finden. Das ist leider auch bei weiteren innovativen Ansätzen auf diesem Gebiet zu befürchten“, so Prof. Matthias Dürst.
Die Impfung führt bis heute zu großen Erfolgen. Erst kürzlich zeigte eine Studie, dass die Fälle von Gebärmutterhalskrebs in England seit der Einführung der Impfung im Jahr 2008 um bis zu 87 Prozent sanken2.
Pap-Test ist Gewinn für Frauengesundheit, aber Optimierungsbedarf bleibt
Dr. Martina Schmitz sagte dazu in der Runde bei Myriam von M: „In Deutschland geht es heute nicht nur darum, Krebserkrankungen zu verhindern. Vielmehr wollen wir die Krebsvorsorge verbessern. Das zeigt sich eindrücklich an den Zahlen: Knapp 4.000 Personen erkranken jährlich an Gebärmutterhalskrebs, wohingegen 400.000 jährlich einen auffälligen Befund erhalten und mit entsprechenden Unsicherheiten konfrontiert sind. Mit GynTect versuchen wir, diese Lücke ein Stück weit zu schließen.“
Letztendlich zeigt sich, dass die Einführung des Pap-Tests in den frühen 70er Jahren ein großer Gewinn für alle Frauen war. Denn er hat substanziell dazu beigetragen, dass invasive Krebsfälle am Gebärmutterhals zurückgingen. Hierzulande sterben jährlich etwa 1.660 Frauen an Gebärmutterhalskrebs, vor gut 30 Jahren war die Zahl noch mehr als doppelt so hoch3. Dennoch besteht dringend Optimierungsbedarf in der Vorsorge. Zum einen treten immer noch Krebsfälle auf und zum anderen geraten sehr viele Frauen in eine Abklärungsschleife und entsprechend psychischen Stress, die nicht ernsthaft erkrankt sind.
Fragen Sie den Arzt oder die Ärztin Ihres Vertrauens
Die hier dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Der Text erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch garantiert er die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Informationen. Er ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer den Arzt oder die Ärztin Ihres Vertrauens!
Quellen
[1] Petry et al, 2007, EJGO
[2] Deutsche Krebsgesellschaft (2021): Rückgang von Gebärmutterhalskrebs durch HPV-Impfung. Online: www.krebsgesellschaft.de
[3] Zentrum für Krebsregisterdaten (2017): Gebärmutterhalskrebs (Zervixkarzinom). Online: www.krebsdaten.de
HIV und Krebs: Erhöhtes Risiko bei HIV-Infektion
BlogDas Humane Immundefizienz-Virus (HIV) greift das Immunsystem an. Das bedeutet, dass infizierte Personen Krankheitserreger schlechter abwehren können. Dadurch steigt auch das Risiko für Betroffene, an Krebs zu erkranken. Damit HIV und Krebs nicht zusammenkommen, sollten die Betroffenen Krebsvorsorgeuntersuchungen daher regelmäßig wahrnehmen.
Warum steigt das Krebsrisiko für Menschen mit einer HIV-Infektion?
Die wahrscheinlichste Ursache für das gestiegene Krebsrisiko liegt darin, dass die Immunantwort des Körpers beeinflusst ist. Er wird schlechter darin, krebsauslösende Viren abzuwehren. Bei Gebärmutterhalskrebs oder auch Kopf-Hals-Tumoren können das Humane Papillomaviren (HPV) sein.
Die Wissenschaft vermutet zudem, dass die durch HIV ausgelöste, chronische Entzündung dazu beiträgt, dass Tumore entstehen. Weiterhin wird vermutet, dass das HI-Virus in das Wachstumsverhalten von Zellen eingreift. Somit schafft es günstige Voraussetzungen dafür, dass sich Krebs entwickelt.
Wichtig ist daher, die HIV-Infektion zu behandeln und das Immunsystem zu stärken. So kann das Krebsrisiko wieder gesenkt werden. Allerdings sind hierzu noch viele Fragen unbeantwortet. Sicher ist leider nur, dass auch die moderne HIV-Therapie keinen vollständigen Schutz bietet.
Studie zeigt sechsfach höheres Risiko für Gebärmutterhalskrebs
Laut einer Studie der Technischen Universität München haben HIV-infizierte Frauen ein sechsmal höheres Risiko, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken. Besonders betroffen sind Frauen aus Süd- und Ostafrika. Bei 63,8 Prozent der Frauen in Süd- bzw. 27,4 Prozent der Frauen in Ostafrika, bei denen Gebärmutterhalstumore festgestellt wurden, lagen zudem HIV-Infektionen vor.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen daher ein signifikant höheres Risiko für Gebärmutterhalskrebs, wenn eine HIV-Infektion vorliegt. HPV-Impfungen sowie frühzeitige Vorsorgeuntersuchungen in den Ländern südlich der Sahara seien von entsprechend hoher Bedeutung. Bisher sind diese allerdings oft kostenpflichtig und werden von zu wenigen Frauen wahrgenommen.
Doch auch in Deutschland betrifft HIV noch immer viele. Ende 2019 lebten hierzulande rund 90.700 Menschen mit HIV.
HPV-Impfung kann bei HIV im Erwachsenenalter sinnvoll sein
Die HPV-Impfung wirkt vorbeugend gegen einige der krebserregenden HPV-Typen. Da sich diese vor allem sexuell übertragen, empfiehlt die Ständige Impfkommission die Impfung eigentlich vor dem ersten Geschlechtsverkehr.
Trotzdem sollten an HIV erkrankte, ungeimpfte Menschen auch im Erwachsenenalter mit ihren Ärztinnen und Ärzten über die Impfung sprechen. Denn wer bisher nur mit wenigen Personen intim geworden ist, hat sich wahrscheinlich noch nicht mit HPV infiziert. In diesem Fall kann eine nachgeholte Impfung z. B. vor Gebärmutterhalskrebs oder Kopf-Hals-Tumoren schützen.
Dabei gilt es zwei Dinge zu beachten: Zum einen übernimmt nicht jede Krankenkasse die Impfkosten. Zum anderen braucht es eine ausreichende Immunfunktion, damit erfolgreich Antikörper gegen HPV gebildet werden. Bei stark immungeschwächten HIV-Patientinnen und -Patienten sollte dies individuell geprüft werden.
Fragen Sie den Arzt oder die Ärztin Ihres Vertrauens
Die hier dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Der Text erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch garantiert er die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Informationen. Er ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer den Arzt oder die Ärztin Ihres Vertrauens!
Quellen
Idw – Informationsdienst Wissenschaft (2020): Sechsfach höheres Risiko: Studie zeigt Zusammenhang zwischen HIV-Infektion und Gebärmutterhalskrebs. www.idw-online.de/de/news760509
Deutsche Krebsgesellschaft (2020): Bei HIV-Infektion: Früherkennungsuntersuchungen für Krebs wahrnehmen. www.krebsgesellschaft.de
Ärztezeitung (2020): Wie HIV-Infektion und Zervixkarzinom zusammenhängen. www.aerztezeitung.de
Deutsches Krebsforschungszentrum (2018): AIDS und HIV: Steigert die Infektion das Krebsrisiko? www.krebsinformationsdienst.de
Deutsche Aidshilfe e.V. (2020): HIV-Statistik in Deutschland und weltweit. www.aidshilfe.de/hiv-statistik-deutschland-weltweit
Grafik: Mary Long/shutterstock.com
Eierstockkrebs: Die stille Gefahr
BlogDeutschlandweit erkranken jährlich etwa 7.300 Frauen an Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom), mehr als 5.000 Betroffene sterben jährlich an den Folgen. Das bedeutet, dass eine von 72 Frauen irgendwann im Leben eine Eierstockkrebs Diagnose erhält. Bei den Betroffenen verändern sich Zellen an einem oder beiden Eierstöcken bösartig und beginnen, unkontrolliert zu wachsen. Da um die Eierstöcke herum viel Platz ist, in dem sich der so entstehende Krebs ausbreiten kann, bemerken viele Frauen die Krankheit erst spät – mit bösen Folgen.
Wer ist betroffen?
Das Risiko für einen Tumor am Eierstock steigt mit zunehmendem Alter. Ab dem 50. Lebensjahr nimmt die Erkrankungsrate kontinuierlich zu. Eierstockkrebs tritt dann gehäuft auf. Im Durchschnitt sind die Betroffenen 69 Jahre alt, wenn sie die Diagnose erhalten. Neben dem höheren Alter gehört auch Übergewicht zu den Eierstockkrebs-Risikofaktoren.
Zudem kann die Krankheit erblich bedingt sein und in einer Familie gehäuft auftreten (sog. familiärer Eierstockkrebs). Besondere Aufmerksamkeit ist daher geboten, wenn Fälle von Eierstock- oder Brustkrebs in der direkten Verwandtschaft bekannt sind.
Zu weiteren Ursachen für Eierstockkrebs können Hormonersatztherapien während der Wechseljahre zählen. Frauen, die sich entsprechend behandeln lassen, erkranken mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an Eierstockkrebs. Die Gefahr sinkt jedoch wieder, wenn die Einnahme der Hormone mindestens zehn Jahre zurückliegt.
Frauen, die Kinder geboren haben, erkranken seltener an Eierstockkrebs. Das gilt auch für diejenigen, die im gebärfähigen Alter die Anti-Baby-Pille genommen oder mindestens ein Kind gestillt haben.
Symptome: Eierstockkrebs wird häufig spät bemerkt
Durch ihre Lage im Bauchraum haben Eierstock-Tumoren viel Platz, um unbemerkt zu wachsen. Die Betroffenen haben deshalb in der Regel lange keine Beschwerden.
Verdachtsmomente können diese sein:
Wenn Ihnen diese Symptome bekannt vorkommen und sie über längere Zeit anhalten, sollten Sie dies von einer Ärztin oder einem Arzt abklären lassen.
Verdacht auf Eierstockkrebs: Untersuchung und Therapie
Wenn ein Verdacht auf einen Tumor an den Eierstöcken besteht, werden diese in einer gynäkologischen Untersuchung abgetastet. Zusätzlich wird oft eine Ultraschalluntersuchung über die Scheide als IGeL-Leistung angeboten. Die Trefferquote hierbei ist kritisch zu betrachten, da Tumoren im Ultraschall nicht von anderen Zysten unterschieden werden können. Wird dennoch ein Tumor im Eierstock entdeckt, entscheidet dessen Stadium über die weitere Behandlung.
Nach der FIGO-Klassifikation (International Federation of Gynecology and Obstetrics) wird Eierstockkrebs in vier Stadien eingeteilt:
Durch die unklaren Symptome für Eierstockkrebs wird die Krankheit oft erst im Stadium III oder IV erkannt. Wenn möglich, entfernen die behandelnden Ärztinnen und Ärzte das Eierstockkarzinom in einer Operation komplett. Daran schließt fast immer eine Chemotherapie an.
Eierstockkrebs: Heilungschancen in frühem Stadium gut
Wird Eierstockkrebs in einem frühen Stadium erkannt, sind die Heilungschancen relativ gut. Die relativen Überlebensraten nach fünf Jahren liegen bei 89 Prozent im Stadium I bzw. bei 77 Prozent im Stadium II. Je weiter der Tumor fortgeschritten ist, desto schlechter stehen die Chancen auf Heilung. Kommt es trotz Operation und Chemotherapie zu einem Rückfall (Rezidiv), kann die Erkrankung nicht mehr geheilt, sondern nur noch palliativ behandelt werden.
Entsprechend wichtig ist eine gute Nachsorge. An die eigentliche Behandlung schließt eine engmaschige Kontrolle mit regelmäßigen Untersuchungen an. Auch eine psychoonkologische Betreuung oder Rehamaßnahmen können sinnvoll sein.
Forschungsprojekt zur Früherkennung
Derzeit gibt es keine spezielle Vorsorgeuntersuchung zur Früherkennung von Eierstockkrebs. In einer Kooperation mit der Frauenklinik des Universitätsklinikums in Jena forschen wir daran, geeignete Tumormarker bei Eierstockkrebs für eine verbesserte Diagnostik zu finden. Mit diesen soll die Krankheit früher erkannt und die Heilungschancen erhöht werden.
Fragen Sie den Arzt oder die Ärztin Ihres Vertrauens
Die hier dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Der Text erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch garantiert er die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Informationen. Er ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch eine Ärztin oder einen Arzt und ist keine Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer den Arzt oder die Ärztin Ihres Vertrauens!
Quellen
Deutsches Krebsforschungszentrum (2020): Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom). www.krebsinformationsdienst.de
Deutsche Krebsgesellschaft (2018): Eierstockkrebs: Basis-Infos für Patienten und Angehörige. www.krebsgesellschaft.de
Zentrum für Krebsregisterdaten (2017): Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom). www.krebsdaten.de
Universitätsklinikum Tübingen: Eierstockkrebs – der stille Feind. www.medizin.uni-tuebingen.de/expertentipps
Austausch in schweren Zeiten: Krebs-Selbsthilfegruppen
BlogVon heute auf morgen kann die Welt aufgrund einer bitteren Diagnose zusammenbrechen: Krebs. Viele Betroffene wissen nicht, was auf sie zukommt und wie sie am besten mit der Situation umgehen. In Selbsthilfegruppen finden sie einen Ort, an dem sie sich gegenseitig seelisch stützen, Fragen zum Krebs beantwortet bekommen und Tipps sowie Erfahrungen austauschen. Wir haben uns über das Thema mit Dirk Rohde unterhalten, der nach überstandener Krebserkrankung Ende 2016 eine Krebs-Selbsthilfegruppe gründete. Diese trifft sich monatlich im Kölner Dysphagiezentrum.
Du bist nicht allein
In der Selbsthilfegruppe kommen Menschen zusammen, die an Krebs erkrankt sind oder kranke Angehörige haben. Alle Teilnehmenden kommunizieren hier auf Augenhöhe über ein Thema, das alle gemeinsam haben. „Wenn jetzt jemand Kopf-Hals-Mund-Krebs hat, der Probleme mit dem Schlucken, Sprechen oder Aussehen hat, weil Kopf-hals-Mund-Krebs auch entstellt, dann können sich gesunde Menschen das schwer vorstellen, wie belastend das sein kann. Aber jemand, der diese Erkrankung und diese psychischen Ängste auch durchgemacht hat, hat eine andere Empathie für diese Gespräche. Da hören wir einander zu. In der Selbsthilfegruppe spüren die Mitglieder, dass sie ernst genommen werden und nicht alleine sind. Dadurch entsteht ein Wir-Gefühl. Gleiche Interessen, gleiche Probleme. So können die Mitglieder sich stützen und unterstützen“, so Dirk Rohde.
Selbsthilfegruppen aufsuchen
Der Zeitpunkt, wann Betroffene und Angehörige eine Selbsthilfegruppe aufsuchen, variiert in jeder individuellen Situation. Manche wollen zeitnah nach der Diagnose eine Zuflucht finden und sich beraten lassen. Andere möchten nach der Therapie einer Selbsthilfegruppe beitreten, da sie während der Strahlen- und Chemotherapie keine Kraft dafür haben.
Zweiteres war bei Dirk Rohde der Fall: „Ich war damit befasst, die Therapie durchzustehen – ich hätte einfach keine Kraft gehabt. Aber nach Ende der Therapie, als ich Zuhause war, da war dann absolute Stille, keine Arztbesuche mehr, nichts. Und dann fangen die Gedanken an zu wandern. Irgendwann kann man wieder anfangen einkaufen zu gehen, nach ein paar Wochen Auto fahren. Das war die Zeit, in der ich mich persönlich nach einem Austausch sehnte. Ich war seelisch und körperlich stark angeschlagen. Hatte Angst zu sterben und davor, dass der Krebs wiederkommt. Bei jedem Pickel hatte ich den Verdacht, dass das wieder ein maligner Prozess ist, bei jedem Halsschmerz die Frage, ob da wieder etwas Neues gewachsen ist. Da wäre der Austausch mit Menschen, die das hinter sich haben und das überlebt haben, sehr hilfreich gewesen. Ich habe dann im Internet gesucht und eine Gruppe gefunden und bin nach Frankfurt gefahren zu einem persönlichen Treffen. In Köln gab es das nicht, also habe ich hier selbst eine Selbsthilfegruppe gegründet.“
Vortrag und Austausch: Ablauf einer Selbsthilfegruppen-Sitzung
Neben dem emotionalen Austausch und fachlichen Vorträgen gilt es in den Sitzungen vor allem das Gefühl zu vermitteln, dass niemand in dieser Situation allein ist.
In Dirk Rohdes Gruppe variieren die Sitzungen inhaltlich: „Ich lade öfter Ärzte für einen Vortrag ein. Das können HNO-Ärzte, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen oder Komplementär-Mediziner sein. Einmal kam der erste Vorsitzende des Vereins Stark gegen Krebs. Doch meistens treffen wir uns einfach zum Austausch. Hier bekommt jeder die Möglichkeit, von seiner Situation zu erzählen. Daraus ergibt sich meist von allein ein reger Austausch, sodass ich für gewöhnlich nur noch die Position des Moderators einnehme. So werden zwei bis drei Stunden leicht gefüllt. Für eine Sitzung finde ich persönlich 10-15 Personen optimal, damit man zu einer homogenen Gruppe wird und jeder zu Wort kommt.“
Selbsthilfe während Corona
Große Herausforderungen für die Organisation der Selbsthilfegruppen gab es seit Anfang der Pandemie. Die Patientinnen und Patienten konnten seltener teilnehmen, da sie durch die Erkrankung zu einer Risikogruppe gehören und eine (lebensgefährliche) Ansteckungsgefahr fürchteten. Darüber hinaus waren Online-Sitzungen aufgrund des höheren Alters vieler Mitglieder schwer umsetzbar.
Dirk Rohde fasst die schwierige Zeit für die Kölner Selbsthilfegruppe so zusammen: „Für Menschen kurz nach der Therapie, die alleine sind, hat sich die Einsamkeit potenziert innerhalb der Corona-Zeiten. Es gab zudem Fälle, in denen man Operationstermine verschoben hat, um Betten freizuhalten. Der Wunsch, dass wir uns dennoch treffen, wurde an mich herangetragen. Es gab dann eine Ausnahme für Treffen medizinischer Selbsthilfegruppen, sodass wir uns zumindest alle paar Monate sehen konnten.“
Sie sind auf der Suche nach einer Selbsthilfegruppe?
Es gibt deutschlandweit zahlreiche Anlaufstellen für Krebserkrankte. Wenn Sie oder ein Ihnen geliebter Mensch erkrankt sind, dann können Sie beispielsweise folgende Organisationen kontaktieren:
Über Dirk Rohde
Dirk Rohde alias Don ist leidenschaftlicher Polizist und erfolgreicher Krebsblogger. Nach der Behandlung seiner Krebserkrankung begann er auf Facebook und Instagram seine Erlebnisse niederzuschreiben und erreicht mittlerweile ein sehr großes Publikum. Seit 2017 hat er seine Tätigkeit als Motorradpolizist wieder aufgenommen.
In seiner Freizeit widmet er sich mit Leib und Seele mehreren ehrenamtlichen Tätigkeiten: Er ist als Patientenbetreuer aktiv im Kopf-Hals-Mund-Krebs e. V. und bietet regelmäßig Erkrankten und ihren Angehörigen Gespräche zur Verarbeitung an. Zudem hilft er als zertifizierter isPO-Onkolotse Menschen, die erstmalig mit der Krebsdiagnose konfrontiert sind, mit Gesprächen und weiterführenden Hilfsprogrammen. So können die Betroffenen die Erkrankung aus psychosozialer Ebene besser bewältigen. Neben der Leitung der Selbsthilfegruppe Köln macht Dirk Rohde vor allem auch den kleinen Patientinnen und Patienten Mut und lenkt sie vom anstrengenden Klinikalltag ab: Er setzt sich seit mehreren Jahren stark für die Kinderkrebshilfe ein.
Zu seinen aktuellen Projekten gehört u. a. die Wanderausstellung „HPV hat viele Gesichter“, die vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg am 13.09.2021 eröffnet wurde.
Mehr zu Dirk Rohde können Sie hier lesen:
Studium und Promotion bei oncgnostics
BlogVon Beginn an arbeiten und forschen immer wieder Studierende der Biologie, Biochemie, Biotechnologie und zurzeit auch Bioinformatik in unserem Team mit. Mittlerweile konnten wir mehr als zehn Abschlussarbeiten betreuen. Vier Mitarbeiterinnen fanden über eine solche Zusammenarbeit ihren festen Platz in unserem Unternehmen. Durch den frischen Input der Studierenden bleiben wir an aktuellen Wissenschaftstrends und Forschungsthemen dran. Gleichzeitig können wir die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von morgen in ihrem Werdegang unterstützen.
So zuletzt unsere Mitarbeiterin Dr. Carolin Dippmann. 2017 fragte sie uns an, ob wir für ihre Promotion in Biotechnologie mit der Medizinischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena kooperieren würden. Damit waren wir natürlich gern einverstanden. Vor kurzem schloss sie nach vier Jahren ihre Promotion ab.
Im Folgenden verrät sie, um was es dabei ging.
Carolin, du hast deine Dissertation zum Thema „Biologie der Marker“ geschrieben, was genau verbirgt sich dahinter?
Krebs zeichnet sich u. a. durch ein verändertes DNA-Methylierungsmuster aus. Das heißt Krebsgewebe zeigt in bestimmten DNA-Abschnitten (diese können je nach Krebsentität unterschiedliche sein) eine chemische Veränderung der Erbinformation (DNA-Methylierung).
Ziel meiner Arbeit war es, diese Veränderungen im Bereich der GynTect® Marker explizit den Krebszellen bzw. entarteten Zellen in den Krebsvorstufen zuzuweisen. Dazu habe ich in Gewebeproben von Patientinnen die Tumorzellen von umliegenden Zellen separiert. Beide Proben untersuchte ich dann getrennt voneinander hinsichtlich ihrer chemischen Modifikation mit Hilfe der Methode der Next Generation Sequenzierung.
Was ist das Besondere an der Next Generation Sequenzierung?
Die Next Generation Sequenzierung ist eine Form der DNA-Sequenzierung. Sie zeichnet sich durch eine parallele Sequenzierung einer sehr großen Anzahl von DNA‑Molekülen, einer geringen Fehlerrate und extremen Datentiefe aus. Durch Anwendung dieser Methode war eine Untersuchung auf tiefstem molekularen Niveau möglich – eine Einzelsequenzanalyse.
Wie bist du auf die oncgnostics als Kooperationspartner für deine Promotion gekommen?
Eine Bekannte berichtete mir von der oncgnostics GmbH und dem Arbeitsgebiet der Firma. Sie hatte in einem Vortrag u. a. gehört, dass hier in Kooperation mit der Klinik für Frauenheilkunde schon einmal ein Stipendium über die Thüringer Aufbaubank (TAB) für eine Doktorandenstelle vergeben wurde. Wie das genau ablief, durfte ich neulich in einem Interview mit der TAB erzählen. Daraufhin nahm ich Kontakt auf und habe angefragt, ob diese Möglichkeit erneut besteht und ob ein Forschungsthema offen sei. Die Chemie hat gestimmt und es wurden die nötigen Schritte für die Schaffung der Doktorandenstelle in die Wege geleitet.
Was hat dich an dem Forschungsbereich fasziniert?
Das Thema Gebärmutterhalskrebs fand ich sehr interessant. Es ist thematisch nah am Menschen und man kann mit dem Begriff etwas anfangen. Vor allem konnte ich durch meine Arbeit einen weiteren Beitrag im Zusammenhang mit dieser Erkrankung liefern.
Wie geht es jetzt weiter?
Ich bleibe im Unternehmen und beschäftige mich als wissenschaftliche Mitarbeiterin mit weiteren Pipeline-Projekten. Außerdem arbeite ich gemeinsam mit unserer nächsten Doktorandin an der Implementierung der Methode der „Oxford Nanopore Sequenzierung“, auch Third Generation Sequencing genannt, im Labor.
Vielen Dank für das Gespräch liebe Carolin! Wir gratulieren auf diesem Weg noch einmal herzlich zur erfolgreichen Promotion und freuen uns, dass du deinen Weg in unsere Reihen gefunden hast.
Wer ebenfalls Interesse an einer Kooperation hat, setzt sich gern mit unserer Geschäftsführung in Verbindung. Hier geht’s zum Kontaktformular.
Titelbild: Susanna Viehmann, Thüringer Aufbaubank
DxPx Partnering Conference Europe
With the gaining importance of diagnostics, digital health, precision medicine and life science tools there‘s a need for a dedicated platform to bring together the relevant stakeholders and further drive our industries.
Together with the support of our sponsors DxPx is hosted as an annual international partnering conference to facilitate licensing, financing, co-development and M&A opportunities and celebrates great success and fast growth.
Deutsche Biotechnologietage 2021
Krebs enttabuisieren: Interview mit Jochen Kröhne (yeswecan!cer gGmbH)
BlogAm 18. und 19. September 2021 findet die zweite YES!CON in Berlin statt. Die größte Krebs-Convention fördert die Kommunikation unter Betroffenen und schafft mehr Aufmerksamkeit für das Thema Krebs. Wir haben uns mit Geschäftsführer Jochen Kröhne über das Event unterhalten und herausgefunden, welche Chancen es für Betroffene und Angehörige birgt.
Herr Kröhne, Ziel der YES!CON ist es, das Thema Krebs in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Woran liegt es, dass dies heute noch nicht der Fall ist? Warum ist es so schwer, über Krebs zu sprechen?
Jochen Kröhne: „Es hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert, aus unserer Sicht zum Positiven. Krebs ist heutzutage weniger ein Tabuthema. Jedoch ist es oft noch mit Scham behaftet und teilweise mit der Angst, berufliche und persönliche Nachteile zu erleben. Statistisch gesehen erkrankt in Deutschland jeder zweite Mensch an Krebs1 und jährlich sind eine halbe Million Menschen betroffen. Diese Zahlen sind in der Gesellschaft noch nicht überall präsent. Dies deutet darauf hin, dass die Leute nicht offen damit umgehen. Wir setzen uns deswegen dafür ein, das Thema Krebs in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Auf der YES!CON geht es hauptsächlich um Patient Empowerment und darum, dass niemand schuld an seiner Krankheit ist. Die Teilnehmenden werden ermutigt, selbstbewusst mit der Krankheit umzugehen.“
Themenschwerpunkt in diesem Jahr ist „Leben mit Krebs“. Welche Infos und Formate erwarten Betroffene und Interessierte bei der YES!CON?
Jochen Kröhne: „Die Palette ist breit und dreht sich rund um das Leben mit Krebs. Wir sträuben uns zudem nicht vor dem Thema „Sterben durch Krebs“: Wie sieht es mit Hospitalisierungs-Angeboten aus? Wie geht man damit um, wenn Menschen austherapiert sind und es nun keine weiteren Optionen gibt? Es gibt auch viele Themen für Familien und zur Forschung, wie Impfungen. Das ist beispielsweise bei Gebärmutterhalskrebs eine tolle Sache, dass es eine Impfung gibt. Und andere mRNA-Stoffe haben auch die große Chance, Krebs zu bekämpfen. Dadurch kann man perspektivisch aggressiven Chemotherapien vorbeugen.“
Die YES!CON stieß im letzten Jahr auf eine große Resonanz. Was sind die Erwartungen für dieses Jahr?
Jochen Kröhne: „Die YES!CON findet dieses Mal vor Ort mit Hygienekonzept statt. Wir hoffen natürlich vor Ort und vor allem online auf mehr Publikum. Es war uns jedoch von Anfang an ein Anliegen, die YES!CON hybrid zu veranstalten. Nicht alle Krebserkrankte können teilnehmen und deswegen bieten wir einen Stream an. Es kann sich jeder barrierefrei anmelden. Darüber hinaus kann man über die YES!App Fragen an Moderatoren einstellen und live mit ihnen interagieren. 2022 werden wir hoffentlich noch mehr Gäste reinlassen und noch mehr Panels anbieten dürfen. Dabei zählen wir stets auf die Unterstützung von prominenten Gästen. Wir haben zum Beispiel Jens Spahn als Schirmherr der Veranstaltung gewonnen. Die Idee ist, dass nicht nur Fachleute kommen, sondern auch Mutmacher und Personen, die politisch und gesellschaftlich aktiv sind. Der Kern der Message soll sein, dass man nicht allein ist.“
À propos Prominente: Sie arbeiten viel mit Influencern zusammen, unter anderem mit Myriam von M, mit der wir auch kooperieren. Was können Betroffene aus Ihrer Sicht am besten vermitteln?
Jochen Kröhne: „Es gibt Menschen, die nicht über ihre Krebserkrankung reden wollen. Und es gibt wiederum Menschen, die das Bedürfnis haben zu reden und anderen Menschen zu helfen. Blogger und Influencer sind so erfolgreich, weil betroffene Leute sich mit ihnen identifizieren können. Es gibt aber auch Prominente, die indirekt betroffen sind. Wie Stefanie Giesinger, Joko Winterscheidt und Tim Mälzer. Wir laden Prominente generell nicht ein, weil sie prominent sind. Sie müssen zur Krankheit einen persönlichen Bezug haben. Ansonsten können sie nicht empathisch und authentisch darüber sprechen.“
Wir von oncgnostics versuchen, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass mehr über Krebserkrankungen gesprochen wird. Wir wissen, dass Aufklärung und Wissen über die Krankheit zentral sind, damit z. B. Patienten im Fall einer Erkrankung frühzeitig eine Diagnose bekommen. Was ist der Wunsch der YES!CON-Veranstalter an uns als Unternehmen, um das Thema Krebs weiter zu enttabuisieren?
Jochen Kröhne: „Wir müssen mehr über Krebs sprechen, um vor allem auf Vorsorgeprogramme aufmerksam zu machen. Eine Krankheit wird behandelt, doch vieles hätte man durch eine frühzeitige Erkennung verhindern können. Das wäre das Allerbeste für alle Krebsarten. Dafür muss diese Krankheit in der Gesellschaft breitflächig thematisiert werden und dafür ist meiner Meinung nach jedes Mittel recht. Ob Emotionen oder Comedy, die Leute sollen abgeholt werden. Wir bekamen schon Kritik wie: „Ihr macht das mit Promis und setzt auf Lifestyle.“ Genau, denn damit erreichen wir junge Menschen und sensibilisieren sie für ein Thema, das sie noch nicht tangiert. Damit kann man das Thema „Krebs“ schneller enttabuisieren, für Aufklärung sorgen und zur Vorsorge bewegen.“
Wer die Veranstaltung verfolgen möchte, kann dies kostenlos online tun: Am 18. und 19. September 2021 über die Website www.yescon.org. Vielen Dank an Herrn Kröhne für das informative Gespräch!
[1] Robert Koch Institut (2017): Krebs in Deutschland für 2013/2014, S. 19
Rezidivverdacht: Ich war richtig zornig
BlogVor einem Rezidiv hatte ich zwar nie direkt Angst, aber das Thema schwebte schon im Hinterkopf herum. Schließlich wusste ich, dass ein Plattenepithelkarzinom sehr rezidivanfällig ist. Mein Name ist Claudia Braunstein, 2011 überlebte ich Krebs am rechten Zungenrand. Drei Jahre später sah ich mich plötzlich mit einem Rezidivverdacht konfrontiert – der Krebs war möglicherweise zurückgekehrt. An dieser Stelle möchte ich meine Erfahrung in einem Gastbeitrag teilen.
Es traf mich völlig unvorbereitet. Ich bin ein Mensch, der gerne zur Nachsorge geht, da das für mich immer eine Bestätigung ist, dass alles in Ordnung ist. Ich hatte auch keinerlei Beschwerden und ging eben alle drei Monate zum MRT. Beim Nachgespräch mit meiner Ärztin, die mich schon durch meine Krankenzeit begleitete, merkte ich sofort, dass etwas anders ist. Dann sagte sie den Satz: „Es tut mir leid, wir müssen etwas Ernsthaftes besprechen. Wir haben etwas gefunden, das da nicht hingehört.“ Ich wurde dann direkt in die Kieferchirurgie überwiesen.
Die Empfangsdame schaute mich an, als wäre ich bereits gestorben. Das Behandlungszimmer war voller Ärzte mit ernsten Gesichtern. Ich bat sie gleich darum, nicht herum zu schwafeln. Ich bin ein sachlicher Mensch, ich kann mit Klartext umgehen.
Ein Rezidiv passt zeitlich gerade gar nicht
Spannend war für mich selbst, was der Verdacht eines Rückfalls mit mir als Patientin gemacht hatte. Ich saß danach im Auto und habe erst einmal geheult. Denn wenn es das sein sollte, was die Ärzte vermuten, dann ist es in einem Teil meines Unterkiefers. Ich hätte eine ähnliche Prozedur wie bei meiner ersten Diagnose zu überstehen, nur mit fataleren optischen Auswirkungen in meinem Gesicht. Ich hatte nicht direkt Angst. Ich wusste, ich hatte das schon einmal überlebt und kann das noch ein zweites Mal schaffen. Ich war richtig zornig.
„Das passte zeitlich überhaupt nicht!“, dachte ich mir. Als würde sowas irgendwann passen. Aber meine Tochter bereitete gerade ihre Hochzeit vor, ich stand kurz vor dem Abschluss meiner psychoonkologischen Ausbildung, außerdem hatte ich noch eine Reise vor.
Pragmatischer Modus: Ich brauche einen tollen Fotografen
Noch im Auto habe ich nicht gehadert, sondern sofort Pläne entwickelt. Mein erster verrückter Gedanke war: Ich muss einen Termin bei einem tollen Fotografen machen. So schön werde ich nie wieder sein! Es ging ja um meinen Unterkiefer. Die Hochzeit meiner Tochter müsste verschoben werden und ich könnte den Vortrag für meinen Abschluss ja jetzt schon per Video aufzeichnen. Das ließe sich ja mit den Verantwortlichen besprechen.
Lange Zeit der Abklärung und Kontrolle
Ein knappes halbes Jahr wurde ich dann sehr engmaschig kontrolliert. Insgesamt hatte ich drei Biopsien. Eigentlich war nach der ersten bereits klar, dass es nicht bösartig ist. Schließlich hatte sich herausgestellt, dass ich durch meine vorangegangene Behandlung einen permanenten Zug auf den Zungenmuskel habe und sich dadurch eine Entzündung entwickelt hat. Der Rezidivverdacht bestätigte sich zum Glück nicht.
Es zeigt sich, wie wichtig Nachsorge ist
Ich bin mental so eingestellt, dass mir nichts Negatives mehr passieren kann. Ein Rezidiv würde nicht lustig werden, aber bringt mich auch nicht um. Ich bin da ein ganz sachlicher Typ und habe das Gefühl, ich wüsste ja, was auf mich zukommen würde. Ich habe meine Situation akzeptiert.
Obwohl ich durch den Rezidivverdacht eine aufreibende Zeit erlebte, bin ich nicht wütend, unnötig beunruhigt worden zu sein. Im Gegenteil: Für mich hat sich die Wichtigkeit der Nachsorge herausgestellt. Denn ich hatte ja keine Beschwerden. Wäre es etwas Ernsthaftes gewesen, wäre es rechtzeitig erkannt worden.
Fotos im Titel: privat; R.E.S Photo
GynTect® in anderen Ländern: Wie sieht die Krebsvorsorge in Portugal und Spanien aus?
BlogWie wird die Krebsvorsorge in anderen Ländern organisiert? Wir reisen in diesem Blogbeitrag nach Portugal und Spanien. Bereits in unserem Beitrag „Cervical Cancer Prevention Atlas: Deutschland nur auf Platz 12“ berichteten wir über die Gebärmutterhalskrebsvorsorge in Deutschland und wie diese im europaweiten Vergleich abschneidet. Im Ranking des European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights (EFP) wurden die Vorsorgemaßnahmen in 46 europäischen Ländern verglichen.
Portugal: Platz 17
In Portugal besteht bei rund fünf Millionen Frauen ab 15 Jahren das Risiko, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken. Dies entspricht knapp der Hälfte der Bevölkerung. Jährlich sind rund 750 Frauen (also 0,02 Prozent aller Frauen in Portugal) von der Diagnose betroffen, etwa halb so viele Personen sterben an der Krankheit.[1] Gebärmutterhalskrebs ist in Portugal die dritthäufigste Krebserkrankung bei Frauen zwischen 15 und 44 Jahren. Schätzungsweise 5,6 Prozent der Frauen in der portugiesischen Allgemeinbevölkerung weisen zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben eine zervikale HPV-Infektion auf, welche auf Gebärmutterhalskrebs hinweisen kann.
Die gute Nachricht: Das 2008 eingeführte Impfprogramm ist erfolgreicher als in Deutschland (Quote bei über 80 Prozent). Doch gibt es in Bezug auf das Screening noch deutliche Defizite. Die jährliche Rate der Pap-Abstriche unter den 25- bis 64-jährigen Frauen liegt gerade einmal bei 54,8 Prozent. Zudem wird die HPV-Problematik vor allem in ländlichen Regionen kaum ernst genommen. So müssen Frauen mit einem positiven HPV‑Befund oftmals mehrere Monate auf eine gynäkologische Nachuntersuchung warten.
Spanien: Platz 25
In Spanien wird jährlich bei fast 2.000 Frauen Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert – 825 Erkrankungsfälle enden leider tödlich[2]. Gebärmutterhalskrebs rangiert auf Platz 15 der häufigsten Krebsarten bei Frauen in Spanien und ist die vierthäufigste Krebserkrankung bei Frauen zwischen 15 und 44 Jahren. Schätzungen zufolge haben 2,7 Prozent aller spanischen Frauen zu einem bestimmten Zeitpunkt eine zervikale HPV‑Infektion mit den zwei Viren, die am häufigsten Krebs auslösen.
Ähnlich wie in Portugal ist die HPV-Impfquote in Spanien im Vergleich zu Deutschland höher (über 70 Prozent). Jedoch bekommt auch Spanien in Bezug auf das Screening-Programm deutliche Abzüge: Nur 60,3 Prozent der Frauen zwischen 15 und 44 Jahren machen alle drei Jahre einen Pap-Abstrich. Im Jahr 2018 hat das spanische Gesundheitsministerium angeordnet, dass bei Frauen alle fünf Jahre ein HPV-Test durchgeführt werden soll. Bisher setzen jedoch nur sehr wenige Regionen dieses Screening-Programm um[3].
Aufmerksamkeit für Frauengesundheit muss in ganz Europa geschaffen werden
Gebärmutterhalskrebs ist die neunthäufigste Krebserkrankung bei den Frauen in Europa. Jährlich sterben europaweit fast 26.000 Frauen daran. Davon werden 3.500 Fälle in Südeuropa gemeldet[4]. Diese Zahl ist im Vergleich zu Osteuropa (über 16.000) weniger gravierend. Dennoch können und sollten diese hohen Todeszahlen in ganz Europa mit mehr Aufklärungsarbeit, Vorsorgemaßnahmen und effizienten Impfkampagnen gesenkt werden.
In Spanien und Portugal wird unser Früherkennungstest GynTect® bereits vertrieben. Unsere internationalen Partner führen hierzu aktuell mehrere Studien durch.
Titelbild: ©TomTom/ Pixabay
[1] https://hpvcentre.net/statistics/reports/PRT_FS.pdf?t=1627551367706
[2] https://hpvcentre.net/statistics/reports/ESP_FS.pdf?t=1627551379599
[3] https://www.hpvworld.com/articles/fact-sheet-spain-www-hpvcentre-net-human-papillomavirus-and-related/
[4] https://hpvcentre.net/statistics/reports/XEX.pdf?t=1627551865306