https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2021/04/Labor_Collage_Website.jpg
321
845
TowerPR
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
TowerPR2021-04-24 09:00:062021-04-19 08:30:59Welttag des Labors am 24. April: Unser Laboralltag in Coronazeiten
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/03/shutterstock_639110809_web.jpg
1280
1920
TowerPR
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
TowerPR2021-04-16 11:52:382021-12-08 15:22:49„OroCa-Graz“- Studie zu Kopf-Hals-Tumoren: oncgnostics GmbH und Medizinische Universität Graz kooperieren
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2021/04/Ernaehrung_0.jpg
321
845
TowerPR
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
TowerPR2021-04-14 09:00:012021-07-07 14:51:47Ernährung bei Krebs: Vielfalt statt Diät
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2024/03/210315_Vertrag_Euroimmun_Website_2.jpg
321
845
TowerPR
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
TowerPR2021-03-25 09:45:182024-03-27 14:57:33Internationale Vertriebspartnerschaft mit EUROIMMUN für GynTect
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2021/03/1506_Blogbeitrag_PCR.jpg
321
845
TowerPR
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
TowerPR2021-03-18 08:00:512021-03-16 14:41:11PCR: Gewissheit in kürzester Zeit
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2021/02/190329_1878HiRes_845px.jpg
321
845
TowerPR
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
TowerPR2021-02-17 05:00:272021-04-06 16:08:15Unser Rückblick 2020 und Ausblick 2021
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2021/02/210201_EFP_Cervical_Cancer_Prevention_Atlas.jpg
321
845
TowerPR
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
TowerPR2021-02-04 06:00:332021-02-09 13:41:20Cervical Cancer Prevention Atlas: Deutschland nur auf Platz 12
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2021/01/shutterstock_1091915696_Blog.jpg
321
573
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2021-01-13 08:39:392021-07-07 14:54:21Symptome Gebärmutterhalskrebs: Vorsorge ist lebensrettend
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/11/Lachsterrine_blog.jpg
201
528
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-12-09 08:57:262020-12-09 18:55:29Lachsterrine – Weihnachtszeit mit Schluckstörung
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/11/202011_Blog_HPV_Impfung.jpg
321
845
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-11-27 11:47:462021-07-07 14:56:52Impfung gegen HPV: Hilfe gegen verschiedene Krebsarten
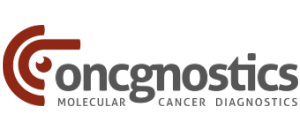
Welttag des Labors am 24. April: Unser Laboralltag in Coronazeiten
BlogWie sieht der Alltag im Labor bei oncgnostics aus? Bereits 2018 gaben wir einen Einblick in unsere Arbeitsstätte, in der wir tüfteln, entwickeln, produzieren und analysieren. Doch seit Beginn der Corona-Pandemie veränderten sich auch bei uns die Arbeitsabläufe. Zum heutigen Welttag des Labors zeigen wir, wie die Abläufe aktuell gestaltet sind.
Die Nachfrage nach unseren GynTect® Diagnostik-Kits zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs hat sich seit 2018 deutlich erhöht und es wurde mehr produziert. Ebenso stieg der interne Verbrauch der GynTect® Kits, denn wir bieten unseren KundInnen Inhouse-Analysen an. Zum anderen geben wir trotz der besonderen Umstände StudentInnen weiterhin die Möglichkeit, ihre Abschlussarbeit bei uns zu schreiben. Auch hierfür kommen GynTect® Kits zum Einsatz.
Zurzeit besteht das Laborteam aus sechs MitarbeiterInnen mit wechselnder Besetzung, um Hygienevorschriften und Abstände einhalten zu können. Alle MitarbeiterInnen sind vor Ort gleichermaßen in der Produktion, in der Forschung und Entwicklung (F&E) und im PCR-Labor tätig.
Arbeiten in Zeiten von Corona
Allgemein hat jede/r aus dem Team zwei feste Präsenztage pro Woche, sodass im Falle einer Infektion nicht die ganze Firma in Quarantäne muss. Außerdem testet sich jede/r zu Beginn der Woche mit einem Corona-Schnelltest.
Am Arbeitsplatz gelten die allgemeinen Hygienemaßnahmen: Hände waschen, Abstand halten, Maske tragen und lüften. Außerdem desinfizieren wir regelmäßig die Türklinken und Telefone, die wir gemeinsam nutzen. Vor allem beim Mittagessen merken wir, dass sich unser Alltag geändert hat: Wir halten Abstand oder essen getrennt voneinander.
Wer nicht zwingend praktisch zu tun hat, meidet trotz aller Hygienemaßnahmen die Räumlichkeiten vor Ort und bleibt im Home-Office. So verlagern sich Tätigkeiten wie die Planung von Versuchen und Auswertung von Experimenten in die Heimarbeit. Wir sind diesbezüglich mittlerweile eingespielt. Die Kommunikation ist dadurch nicht abgerissen, da wir Meetings nun virtuell über unsere Gruppen-Tools halten und regelmäßig telefonieren.
Alltag im Labor: Absprachen sind das A und O
Unter den aktuellen Corona-Bedingungen sind Absprachen wichtiger denn je: Auf 10m2 darf sich nur eine Person bewegen. Das bedeutet, dass sich zurzeit nur drei Personen gleichzeitig den Raum für F&E aufhalten dürfen. Gleiches gilt für das Produktionslabor. Falls doch mehr Personen praktisch tätig sein müssen oder während der Produktion den Abstand nicht gewahrt werden kann, tragen wir Masken.
Normalerweise gibt es feste Sitzplätze im F&E-Labor. Obwohl das Labor grundsätzlich genug Platz für paralleles Arbeiten bietet, sprechen wir uns im Vorfeld immer ab, um eine Überbelegung zu vermeiden. Damit alle ihre geplanten Labortätigkeiten vor Ort durchführen können, ist eine gute Kommunikation nötig. Dazu gehört zum Beispiel die Organisation der Belegung von Laborgeräten, was reibungslos klappt.
Die coronabedingten Hygienemaßnahmen erschweren die Abläufe im PCR-Labor
Im PCR-Labor waren die Sicherheitsvorkehrungen unabhängig von Corona schon immer sehr streng. Hat eine Kollegin beispielsweise das PCR-Labor einmal betreten, so darf sie an diesem Tag nicht mehr in das Produktionslabor. Das liegt daran, dass im PCR-Labor die DNA-Vervielfältigung der Biomarker stattfindet. Diese DNA darf auf keinen Fall mit den Komponenten und Chemikalien, die bei der Herstellung von GynTect® im Produktionslabor zum Einsatz kommen, in Berührung kommen. Es besteht hier Kontaminationsgefahr. Mit dieser Regelung werden also die im Produktionslabor hergestellten GynTect® Kits absolut sauber gehalten. Uns an strikte Hygienevorschriften zu halten, sind wir deshalb schon gewohnt.
Da sich mit der Einführung der Corona-Maßnahmen nun aber deutlich weniger MitarbeiterInnen vor Ort befinden, erschwert dies manchmal die Organisation der Produktionsabläufe. Es kommt vor, dass viele Arbeiten im PCR-Labor anstehen und danach einige KollegInnen die Produktion nicht mehr betreten dürfen. Tage, an denen die Produktion besetzt sein soll, müssen also vorher gut geplant werden, da an einem Herstellungsprozess mindestens drei MitarbeiterInnen beteiligt sind.
Mittlerweile ist die Umsetzung der Maßnahmen Routine für uns geworden. Aus der Teilung in Home-Office und praktisches Arbeiten konnten wir sogar Vorteile ziehen: Für einige entfällt der lange Arbeitsweg an Home-Office-Tagen und die freie Zeiteinteilung der Arbeit zuhause erleichtert den Corona-Alltag. Nichtsdestotrotz freuen wir uns auf eine Zeit, in der eine freie Begegnung mit allen KollegInnen wieder möglich ist.
„OroCa-Graz“- Studie zu Kopf-Hals-Tumoren: oncgnostics GmbH und Medizinische Universität Graz kooperieren
Blog, PressemeldungDas Biotechnologie-Unternehmen oncgnostics GmbH forscht gemeinsam mit der klinischen Abteilung für allgemeine HNO der Medizinischen Universität Graz im Rahmen der Studie „OroCa-Graz“ an einem Verfahren zur Diagnostik von Kopf-Hals-Tumoren. 550.000 Menschen erkranken weltweit jährlich an Karzinomen dieser Art. Da oft erst fortgeschrittene Tumorstadien diagnostiziert werden, sterben über 300.000 der Betroffenen pro Jahr. Die Studie möchte nachweisen, dass das entwickelte Diagnostikverfahren für Kopf-Hals-Tumoren und speziell Mund-Rachenkrebs (= Oropharynxkarzinom) anhand von nicht-invasiven Speichelproben bösartige Tumoren frühzeitig und sicher erkennen kann.
Übermäßiger Alkohol- und Tabakkonsum zählen zu den Hauptrisikofaktoren für Kopf-Hals-Tumoren. Daneben wurden in den letzten Jahren verstärkt Karzinomfälle im Mund-Rachen-Bereich verzeichnet, bei denen eine Infektion mit dem humanen Papillomavirus (HPV) vorlag. Die Rate an diesen HPV-assoziierten Karzinomen steigt jährlich um 2,1 Prozent. Nicht-HPV-assoziierte Kopf-Hals-Karzinome sanken im gleichen Zeitraum leicht um 0,4 Prozent[1]. In Deutschland wird von einem derzeitigen Anteil von 40 Prozent HPV-induzierter Erkrankungen ausgegangen, Tendenz steigend[2].
Die Studienleitung der „OroCa-Graz“-Studie liegt bei Prof. Dr. Dietmar Thurnher, Abteilungsleiter der Allgemeinen HNO der Medizinischen Universität Graz. Er erklärt: „Trotz zunehmender Fälle erzielte die Therapie von Kopf-Hals-Tumoren in den letzten 20 Jahren keine wesentlichen Fortschritte. Zusätzlich zu den Neuerkrankungen kehrt bei der Hälfte der Patientinnen und Patienten in den zwei Jahren nach Therapieabschluss der Krebs als sogenanntes Tumorrezidiv zurück. Zudem ist für Kopf-Hals-Tumoren bislang keine Frühdiagnostik etabliert. Das wollen wir ändern. Indem wir Oropharynxkarzinome, HPV-Infektionen und DNA-Methylierungsmarker in ihrer Beziehung zueinander untersuchen, entstehen neue Wege der Frühdiagnostik sowie der Sekundär- und Tertiär-Prävention.“
Die Sekundärprävention richtet sich an Personen mit einem erhöhten Krankheitsrisiko, zum Beispiel RaucherInnen. Mit Vorsorgeuntersuchungen, Abklärungs- und Screeningtests könnten bösartige Erkrankungen besonders in Risikogruppen frühzeitig diagnostiziert oder Auffälligkeiten abgeklärt werden. Bislang wird dabei der Rachen nur inspiziert, wenn bereits Beschwerden auftreten. Maßnahmen der Tertiärprävention richten sich an TumorpatientInnen, die sich nach einer Therapie in regelmäßiger klinischer Nachsorge befinden.
„OroCa-Graz“: Studienablauf
Im Rahmen der „OroCa-Graz“-Studie werden Gewebe- und Speichelproben von PatientInnen mit einem Oropharynxkarzinom vergleichend untersucht. Über die Abgabe einer einfachen Speichelprobe sollen Beschwerden im Kopf-Hals-Bereich später abgeklärt werden können. Der Nachweis einer bösartigen Erkrankung erfolgt über die Detektion von tumorspezifischen DNA-Methylierungsmarkern, die von oncgnostics entwickelt wurden. Zudem wird der HPV-Status aller Proben bestimmt. Anhand dieser Ergebnisse analysieren die WissenschaftlerInnen, wie sensitiv die Tumorerkennung durch die Methylierungsmarker ist und ob ein Zusammenhang zwischen dem Auftreten der Tumormarker und einer HPV-Infektion besteht.
Weitere Speichelproben werden während der Nachsorge entnommen. Die Idee ist, dass Tumormarker, die bereits im Primärtumor nachgewiesen wurden bei der Entstehung von Rezidiven erneut auftreten. Werden die Tumormarker in der Nachsorge nachgewiesen, kann entsprechend frühzeitig eingeschritten werden.
Forschung an DNA-Methylierungsmarkern seit 2012
Die oncgnostics GmbH beschäftigt sich seit ihrer Gründung 2012 speziell mit der Suche nach DNA-Methylierungsmarkern, auch für Kopf-Hals-Tumoren. Bisher wurde für die Erkrankung ein Set an potentiellen Tumormarkern anhand von Gewebe- und Abstrichproben etabliert. Einer dieser Tumormarker findet bereits Anwendung in der Diagnostik von Gebärmutterhalskrebs im Test GynTect®.
„Änderungen im DNA-Methylierungsmuster entstehen frühzeitig in der Tumorentwicklung. Über den Nachweis unserer krebsspezifischen Biomarker können wir daher beispielsweise prüfen, ob Krebsvorstufen vorliegen. Die Anwendung könnte zukünftig ein leistungsstarkes Werkzeug für die frühzeitige Erkennung im Rahmen einer Krebsvorsorge darstellen sowie als Teil der Nachsorgeuntersuchung bei Oropharynxkarzinomen gelten“, so Dr. Martina Schmitz, Geschäftsführerin der oncgnostics GmbH.
[1] Universität Leipzig (2020): Oropharynxkarzinom: Gute Prognose – aber nicht für alle Patienten. Online unter: https://www.quintessence-publishing.com/deu/de/news/nachrichten/bunte-welt/oropharynxkarzinom-gute-prognose-aber-nicht-fuer-alle-patienten
[2] Wagner S. et al. (2018): Das HPV-getriebene Oropharynxkarzinom – Inzidenz, Trends, Diagnose und Therapie. In: Der Urologe 57:1457–1463. Online unter: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28713770/
Pressemitteilung
Studie zu Kopf-Hals-Tumoren:
oncgnostics GmbH und Medizinische Universität Graz kooperieren
Ernährung bei Krebs: Vielfalt statt Diät
BlogIm Fall einer Krebserkrankung ist es wichtig, frühzeitig auf eine ausgewogene und kalorienreiche Ernährung zu achten. Nur so kann der Körper gegen das Schwächerwerden ankämpfen und den Verlauf der Krebserkrankung verträglicher gestalten. Denn die Krankheit schwächt die Abwehrkräfte. Zusätzlich strapaziert die Therapie den Körper. Viele PatientInnen klagen während und nach einer Chemo- oder Strahlentherapie über Müdigkeit, Übelkeit und Entzündungsreaktionen der Speiseröhre oder Schleimhäute. Daraus resultieren meist Appetitlosigkeit und ein Gewichtsverlust.
Mit einer vorsorglichen Ernährungstherapie bei Kräften bleiben
Krankheitsbedingter Gewichtsverlust und Nährstoffmangel können durch eine frühzeitige Untersuchung des Ernährungszustandes sowie eine regelmäßige Gewichtskontrolle vorgebeugt werden. Dabei werden der Body-Mass-Index (BMI) und der unbeabsichtigte Gewichtsverlust dokumentiert. Beispielsweise spricht die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin e.V. (DGEM) von einer krankheitsspezifischen Mangelernährung, wenn ein/e PatientIn bei einem BMI von >18,5 einen Gewichtsverlust von 10-15 % innerhalb von sechs Monaten vorweist[1]. Verliert also eine 1,65 m große Frau mehr als 6,5 kg innerhalb eines halben Jahres, sollten die Alarmglocken läuten. Auf diese Weise können die ÄrztInnen vorzeitig Defizite erkennen und entsprechend eingreifen, wobei ErnährungsberaterInnen unterstützen können.
Vielseitiger Ernährungsplan statt Krebsdiät
Der Ernährungszustand während einer Krebserkrankung und -therapie ist von verschiedenen Faktoren abhängig: Der individuelle Status der Erkrankung, das Alter, der Allgemeinzustand und ggf. weitere Erkrankungen können einen Einfluss auf die Nahrungszufuhr haben. Daher ist es wichtig, die Ernährungsweise anzupassen, um die Therapieverträglichkeit, das Wohlbefinden und die Überlebenszeit positiv zu beeinflussen. Je vielfältiger und nährstoffreicher die Ernährung ist, umso effektiver können die PatientInnen Energie schöpfen. Besonders auf eine erhöhte Zufuhr von Proteinen sollte geachtet werden, um Muskelschwäche vorzubeugen. Das Deutsche Krebsforschungszentrum (dkfz) empfiehlt etwa 1,2-1,5 g/kg Körpergewicht pro Tag[2].
Erkrankten PatientInnen wird zudem von sogenannten „Krebsdiäten“ abgeraten. Beispielsweise werden bei der „Gerson-Diät“ ausschließlich pflanzliche Lebensmittel mit reduzierter Fett- und Proteinzufuhr aufgenommen. Der Körper soll dadurch entgiftet und die Abwehrkräfte gestärkt werden. Für solche alternativen und meist einseitigen Kostformen, die eine Besserung bzw. Heilung von Tumorleiden versprechen, gibt es laut DGEM keine „wissenschaftlich akzeptable Beweisführung“[3]. Vielmehr gehen die PatientInnen das Risiko ein, ihre ohnehin eingeschränkte Nahrungsaufnahme durch den bewussten Verzicht auf Nährstoffe zu verschlechtern.
Nachhaltiger Lebensstil zahlt sich aus
Nach wie vor ist Prävention der wichtigste Faktor für ein gesundes Leben: Schützen Sie sich zum Beispiel gegen Gebärmutterhalskrebs mit einer Impfung gegen HP-Viren, regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen und einem ausgewogenen Lebensstil. Grundsätzlich gilt: Ein geschwächtes Immunsystem begünstigt das Risiko, an einer Infektion zu erkranken. Bereits mit ausreichend Schlaf und Bewegung sowie einer gesunden Ernährung kann man dieses Risiko senken. Ebenso sollte auf Zigaretten, Zucker und Alkohol verzichtet werden.
Folgende Empfehlungen in Bezug auf die Ernährung bei Krebs spricht das dkfz aus[4]:
Ernährung bei Gebärmutterhalskrebs
Wie bereits geschildert, gibt es auch bei Gebärmutterhalskrebserkrankungen keine speziellen Diäten. Verschiedene Faktoren während der Behandlung können jedoch Einfluss auf die Ernährung haben[5]:
Weitere Tipps und Rezepte, die auf Nebenwirkungen wie Übelkeit, Durchfall oder Bauchkrämpfe abgestimmt sind, gibt es auf was-essen-bei-krebs.de. Dieses Projekt wurde vom gemeinnützigen Verein Eat What You Need e.V. – Allianz für bedarfsgerechte Ernährung bei Krebs in Kooperation mit dem CCC München Comprehensive Cancer Center am Klinikum der Universität München Ludwig-Maximilians-Universität ins Leben gerufen.
Shiitake-Pilze: Heilmittel gegen HP-Viren oder nur ein Hype?
In einigen Ländern Asiens, z.B. China und Japan, gelten Shiitake-Pilze schon lange als Heilmittel, doch auch in Deutschland erfreuen sie sich immer größerer Beliebtheit. Ihnen werden neben guten Geschmacks- und Würzeigenschaften („Umami“) heilende Kräfte gegen Entzündungen, Schmerzen und sogar Krebs nachgesagt. Unter anderem enthält der Pilz den Inhaltsstoff Active Hexose Correlated Compound (AHCC), der regenerierende und antivirale Wirkungen haben soll. Demnach soll AHCC gegen HP-Viren ankämpfen .
In Deutschland haben die Shiitake-Pilze keinen Stellenwert in der Krebstherapie[6], da es aktuell keine aussagekräftigen Studien über die Wirksamkeit von AHCC gibt. Außerdem warnt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) vor möglichen Hautausschlägen beim (übermäßigen) Verzehr dieser Pilze. Betroffen sind hier allerdings nur wenige Menschen, die besonders empfindlich auf den natürlichen Inhaltsstoff Polysaccharid Lentinan reagieren[7].
Ob krank oder gesund – wir sind, was wir essen. Deshalb sind eine ausgewogene Ernährung und ein gesunder Lebensstil die Grundlage für gute Lebensqualität.
Fragen Sie die Ärztin oder den Arzt Ihres Vertrauens
Die hier dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Der Text erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch garantiert er die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Informationen. Er ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer den Arzt oder die Ärztin Ihres Vertrauens!
Literatur:
[1] Mangelernährung – Was ist das? In: Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin e.V. Online verfügbar: https://www.dgem.de/definition-mangelern%C3%A4hrung
[2] ERNÄHRUNG BEI KREBS: Was ist wichtig? In: Krebsinformationsdienst, Deutsches Krebsforschungszentrum, 15. Januar 2020. Online verfügbar: https://www.krebsinformationsdienst.de/service/iblatt/iblatt-ernaehrung-bei-krebs.pdf
[3] Klinische Ernährung in der Onkologie. In: S3-Leitline der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin e.V. (DGEM) in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie e. V. (DGHO), der Arbeitsgemeinschaft „Supportive Maßnahmen in der Onkologie, Rehabilitation und Sozialmedizin“ der Deutschen Krebsgesellschaft (ASORS) und der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für klinische Ernährung (AKE). Oktober 2015. Online verfügbar: https://www.dgem.de/sites/default/files/PDFs/Leitlinien/S3-Leitlinien/073-006l_S3_Klin_Ern%C3%A4hrung_in_der_Onkologie_2015-10.pdf
[4] Ernährung und Krebs. In: Krebsinformationsdienst, Deutsches Krebsforschungszentrum, 2020. Online verfügbar: https://www.dkfz.de/de/nationale-krebspraeventionswoche/ernaehrung-und-krebs.html
[5] Gebärmutterhalskrebs: Leben mit und nach der Erkrankung. In: Krebsinformationsdienst, Deutsches Krebsforschungszentrum, 9. November 2016. Online verfügbar: https://www.krebsinformationsdienst.de/tumorarten/gebaermutterhalskrebs/leben.php
[6] Shiitake: Harmloser „Heilpilz“? In: Krebsinformationsdienst, Deutsches Krebsforschungszentrum, 20. Oktober 2016. Online verfügbar: https://www.krebsinformationsdienst.de/aktuelles/2016/news78-shiitake-pilze.php
[7] Gesundheitliches Risiko von Shiitake-Pilzen. In: Bundesinstitut für Risikobewertung, 34. Juni 2004. Online verfügbar: https://www.bfr.bund.de/cm/343/gesundheitliches_risiko_von_shiitake_pilzen.pdf
Titelbild: www.pixabay.com
Internationale Vertriebspartnerschaft mit EUROIMMUN für GynTect
PressemeldungDas Biotechnologie-Unternehmen oncgnostics GmbH startet eine Vertriebspartnerschaft mit dem internationalen Diagnostikkonzern EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG. Im Rahmen der Zusammenarbeit vertreibt EUROIMMUN den Gebärmutterhalskrebstest der oncgnostics GmbH, GynTect, zunächst in den europäischen Ländern Portugal, Italien, Türkei und Polen. Es wird außerdem erwartet, dass der Test bis Ende 2021 in Kanada zugelassen ist und dort in den Verkauf gehen kann.
Anlass der Kooperation ist die wertvolle Ergänzung der Produktportfolios: EUROIMMUN verkauft seit nunmehr sieben Jahren erfolgreich den EUROArray HPV, einen molekulargenetischen Test zum Nachweis und zur vollständigen Genotypisierung humaner Papillomaviren, kurz HPV. Der Test von EUROIMMUN kann eine HPV-Infektion bei Frauen mit einer sehr hohen Sicherheit erkennen. Jedoch führt nicht jede HPV-Infektion zu einer ernsthaften Erkrankung. Die meisten von einer HPV-Infektion betroffenen Frauen sind gesund, die Infektion heilt von allein aus. Diese Entwicklung vorherzusagen, kann jedoch kein HPV-Test leisten. An dieser Stelle setzt der von der oncgnostics GmbH entwickelte Test GynTect an. Die Innovation des Tests besteht in der sicheren Erkennung von DNA-Methylierungen, die nur bei der Entwicklung von Krebszellen vorliegen. Somit kann eine bösartige Veränderung, die sich zu Krebs entwickeln kann, durch GynTect entdeckt werden.
„Mit der Aufnahme von GynTect in unser Produktangebot verfügt EUROIMMUN ab sofort über ein Komplettpaket für die Gebärmutterhalskrebsdiagnostik“, begrüßt Dr. Wolfgang Schlumberger, Vorstandsvorsitzender von EUROIMMUN, die Kooperation. „Der EUROArray HPV hilft dank eindeutiger Typisierung von insgesamt 30 HPV-Subtypen das individuelle Krebsrisiko der Patientinnen einzuschätzen. Mit GynTect kann dieses Risiko nun im nächsten Schritt noch weiter präzisiert werden. So kann ein negativer GynTect-Test für viele Frauen mit einer nachgewiesenen HPV-Infektion frühzeitig die erhoffte Entwarnung geben.“ Die GynTect-Tests stellt oncgnostics im eigenen Produktionslabor in Deutschland her. Sie werden über EUROIMMUN international an Labore verkauft, die die Tests dezentral in den verschiedenen Ländern durchführen und auswerten.
Weitere Länder in Planung
Parallel zu den ersten vier EU-Ländern und Kanada soll der GynTect-Test schrittweise in weitere EU-Märkte eingeführt werden. „Die Bekämpfung von Gebärmutterhalskrebs begreifen wir als globale Herausforderung. Neben der flächendeckenden Impfung spielen präzise Vorsorge-Tests hier eine große Rolle. Wir freuen uns sehr, dass wir über die Partnerschaft Zugang zu dem gut ausgebauten Vertriebsnetzwerk von EUROIMMUN erhalten. Indem wir neue Kontakte zu Laboren, Ärztinnen und Ärzten gewinnen, profitieren immer mehr Frauen von den Vorteilen von GynTect. Darauf bauen wir auf und sind gespannt auf die Zusammenarbeit“, so sagt Dr. Martina Schmitz, Geschäftsführerin der oncgnostics GmbH.
Wir von der oncgnostics GmbH forschen und entwickeln Krebstests auf molekularbiologischer Basis. Eines unserer Produkte ist GynTect, ein Test auf Gebärmutterhalskrebs. Er ist in der Lage, Gebärmutterhalskrebs bereits in seinen Vorstufen zu erkennen. Für seine Durchführung ist ein gynäkologischer Abstrich beim Frauenarzt ausreichend.
Pressemitteilung
Internationale Vertriebspartnerschaft:
Oncgnostics und EUROIMMUN kooperieren für Vertrieb des
Gebärmutterhalskrebstests GynTect
PCR: Gewissheit in kürzester Zeit
BlogDie Methode der PCR (= Polymerase chain reaction) steht für die Polymerase-Kettenreaktion. Das dahinterstehende Verfahren hat die medizinische und biotechnologische Forschung grundlegend verändert und gilt heute als wichtigste Labormethode zur Untersuchung der molekularen Struktur unserer Erbsubstanz (= DNA). Das liegt unter anderem daran, dass die PCR Methode vielseitig einsetzbar ist. Sie findet in allen oncgnostics-Projekten Anwendung und ist elementarer Bestandteil unseres Tests auf Gebärmutterhalskrebs GynTect. Bekanntheit erreichte der PCR Labortest zuletzt jedoch durch seinen Einsatz beim aktuell weltweiten Testen von Corona-Proben.
Wofür wird die PCR angewendet?
Labore verwenden die Methodik für die Vervielfältigung von DNA in kürzester Zeit. Schnelldurchläufe, sogenannte Fast-PCRs, erfolgen innerhalb von 10 Minuten. Andere dauern zwischen einer und zwei Stunden.
Nehmen wir unseren Gebärmutterhalskrebstest GynTect: Ziel der PCR ist hierbei herauszufinden, ob bestimmte, epigenetisch veränderte Gensequenzen vorliegen, die nur in Krebszellen vorkommen. Diese werden als methylierte DNA bezeichnet.
Um diese Frage via PCR-Diagnostik zu klären, benötigt man Folgendes:
Polymerase Kettenreaktion: Ablauf im Thermocycler
Die Vervielfältigung der DNA erfolgt in der Regel in drei Schritten in einem sogenannten Thermocycler. Dieses Laborgerät regelt die exakten Temperaturen während der biochemischen Reaktion.
Innerhalb von 30 Sekunden bilden sich in der letzten Phase etwa 500 Basenpaare. Die Länge des dritten Schritts hängt davon ab, wie lang die untersuchte DNA-Sequenz ist. Sobald der dritte Schritt abgeschlossen ist, startet ein neuer PCR-Zyklus. Dadurch vermehrt sich die DNA in den Bereichen der nachzuweisenden Marker exponentiell. Bereits nach 30 Zyklen können über eine Milliarde Kopien vorliegen. Der gesamte Ablauf dauert in der Regel eine Stunde.
Wichtig: Die Vervielfältigung der DNA-Probe passiert nur, wenn sie die gesuchte Gensequenz enthält. Im Fall von GynTect oder auch Corona wäre die DNA-Probe in diesem Fall positiv.
PCR Diagnostik: Was passiert bei der Anwendung von GynTect?
Bei der Durchführung von GynTect wenden wir das beschriebene Verfahren an. Falls eine Methylierung der DNA für die entsprechende Gensequenz vorliegt, die ausschließlich in Krebszellen und Krebsvorläuferzellen vorkommt, kann die DNA mithilfe der spezifischen GynTect-Primer vervielfältigt werden. Das Ergebnis ist positiv. In diesem Fall leuchtet die Probe auf.
Für das optische Signal wenden wir einen bestimmten Fluoreszenzfarbstoff an. Dieser lagert sich in den aufeinanderfolgenden Zyklen immer wieder in doppelsträngige DNA-Stücke ein, die die PCR erzeugt. Je mehr vervielfältige DNA vorhanden ist, desto stärker ist das Leuchtsignal. Der Zyklus, ab dem das entstehende Leuchtsignal signifikant das Hintergrundleuchten überschreitet, wird als Cycle Threshold, auch Ct-Wert bezeichnet. Für den GynTect Test ist ein bestimmter Anteil methylierte DNA mindestens notwendig, damit eine Probe als positiv erkannt wird. Der Anteil liegt jedoch bei weniger als einem Prozent.
Ist die Probe negativ, wird keine Methylierung der DNA nachgewiesen. Die PCR erzeugt in diesem Fall keine DNA-Fragmente und der Farbstoff lagert sich nirgends ein. Dementsprechend gibt die Probe kein Leuchtsignal ab.
Die Vorbereitung der PCR für GynTect sehen Sie in diesem Video im Schnelldurchlauf.
Vorteil und Geschichte der PCR-Methode
Der klare Vorteil der Methode liegt in der einfachen Handhabbarkeit. Das Tool weist unkompliziert und zielgerichtet bestimmte Erbinformationen nach. Zentral ist hierbei, dass die Primer die Zielsequenz spezifisch erkennen. Im Beispiel von GynTect wenden wir Primer an, die nur auf bestimmte, in diesem Fall sechs verschiedene, Genregionen passen und das ausschließlich dann, wenn diese vorher methyliert vorlagen.
Die Forschung zu der Diagnostik-Methode geht bis in die 1950er Jahre zurück. In ihrem heutigen Sinn wurde sie 1983 erfunden und bereits 10 Jahre später, 1993, mit dem Chemienobelpreis ausgezeichnet. Heute sind in den meisten Laboren viele verschiedene PCR-Thermocycler im Einsatz. In einem früheren Blogbeitrag haben wir gezeigt, wie genau unser Labor und der Arbeitsalltag in diesem aufgebaut ist.
Unser Rückblick 2020 und Ausblick 2021
Blog2020 war ein turbulentes und herausforderndes Jahr. Dennoch blicken wir auf erfolgreiche Meilensteine zurück und freuen uns im Ausblick auf die kommenden Projekte.
GynTect® überzeugt im Testvergleich
Im November veröffentlichte das Fachjournal Clinical Epigenetics eine vergleichende Studie zu Tests in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge. GynTect wurde zusammen mit dem QIAsure-Test, der ebenfalls auf epigenetischen Markern basiert, an einer Patientinnenpopulation getestet. Beide Tests können eingesetzt werden, um klinisch relevante, HPV-induzierte Gewebeveränderungen am Muttermund zu erkennen, die sich zu Krebs entwickeln können. Ziel der Studie war es, neben der Sensitivität auch die Spezifität der Tests zu vergleichen. Also herauszufinden, wie häufig die Tests ein falsch-positives Ergebnis liefern. Beide Tests zeigten eine sehr gute Erkennungsrate für hochgradige Läsionen und speziell für Krebserkrankungen. Jedoch war bei GynTect® die Spezifität deutlich höher, also die Rate der falsch-positiven Ergebnisse unter den gesunden HPV-positiven Frauen, sehr viel niedriger. Daher sollte GynTect® aufgrund seiner höheren Spezifität für CIN2+ oder CIN3+ vorzugsweise genutzt werden.
Wir sind aktiv in der Forschung trotz Corona
Im August 2020 erschien eine Studie über die psychische Belastung von Frauen bei Auffälligkeiten in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge, an welcher wir mitwirkten. An dieser wissenschaftlich gestützten Online-Befragung nahmen mehr als 3.700 Frauen teil. Frauen mit auffälligem Pap-Befund oder einer HPV-Infektion gaben unter anderem an, dass sie Sorge tragen, an Krebs zu erkranken. Und das, obwohl weder ein auffälliger Pap-Befund noch eine HPV-Infektion einen sicheren Hinweis auf eine Krebserkrankung bietet. Knapp die Hälfte der Betroffenen äußerten sogar die Befürchtung, an Gebärmutterhalskrebs sterben zu können. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Archives of Gynecology and Obstetrics veröffentlicht.
Weiterhin erzielten wir wichtige Fortschritte in unserem Projekt zur Diagnostik von Kopf-Hals Tumoren: Seit 2019 entwickeln wir Tests basierend auf DNA-Methylierungsmarkern, die bei Krebserkrankungen im Mund- und Rachenraum eingesetzt werden sollen. 2020 startete die dazugehörige Studie „OncSaliva“ an der HNO-Klinik Jena. Bis Ende des ersten Quartals 2021 werden noch vier weitere Zentren hinzukommen. Insgesamt geben 150 Patientinnen und Patienten zum Zeitpunkt ihrer Krebs-OP eine Speichel- und Blutprobe ab. Außerdem wird Gewebe aus dem Tumor analysiert. In diesen Proben weisen wir unsere Methylierungsmarker nach. Auch 150 gesunde ProbandInnen werden eingeschlossen, von denen Gewebe und Speichelproben gesammelt werden. In der auf eine Operation routinemäßig erfolgenden Nachsorge geben die in die Studie eingeschlossenen PatientInnen bis zu zwei Jahre lang regelmäßig Speichelproben zur Rezidiverkennung ab. Wir analysieren anschließend die Methylierungsmarker im Speichel. Mithilfe dieser nicht-invasiven Methode soll im Follow-Up eine möglichst frühzeitige Rezidiverkennung ermöglicht werden. Die Studie läuft noch bis Ende 2023.
Ausblick 2021: Neue Kooperation und Auftritt auf der Eurogin
Im Mai liegen die Ergebnisse der GynTect-PRO-Studie vor. 2017 starteten wir die dreijährige Verlaufsstudie mit dem GynTect-Testverfahren. Die Studie berücksichtigt die Daten von Patientinnen in zehn Studienzentren in Deutschland. Sie soll zeigen, dass junge Patientinnen mit einem negativen GynTect-Ergebnis trotz Gewebeveränderungen am Muttermund keinen Gebärmutterhalskrebs entwickeln, sondern die Zellveränderungen von allein ausheilen.
Außerdem freuen wir uns auf die nächste erfolgreiche Etappe in unserem internationalen Vertrieb: Unlängst schlossen wir eine Partnerschaft mit dem internationalen Diagnostikkonzern EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG ab.
Save the Date: Wir sind auf dem internationalen, multidisziplinären HPV-Kongress Eurogin vom 30. Mai bis 1. Juni 2021 mit einem Messestand vertreten.
Wir von der oncgnostics GmbH forschen und entwickeln Krebstests auf molekularbiologischer Basis. Eines unserer Produkte ist GynTect, ein Test auf Gebärmutterhalskrebs. Er ist in der Lage, Gebärmutterhalskrebs bereits in seinen Vorstufen zu erkennen. Für seine Durchführung ist ein gynäkologischer Abstrich beim Frauenarzt ausreichend.
Titelbild: Pharma-Biotechnologin Theresa Erler im oncgnostics Labor / © Eberhard Schorr
Cervical Cancer Prevention Atlas: Deutschland nur auf Platz 12
BlogDie Bemühungen zur Gebärmutterhalskrebsvorsorge weisen innerhalb Europas große Unterschiede auf. Während Belgien, Dänemark, Irland und Großbritannien gute Präventionsstrategien zeigen, verfügen andere Länder z. B. über keine klaren Regelungen zu HPV-Impfungen. Auch in Deutschland ist noch Luft nach oben. Das verdeutlicht eine aktuelle Studie des European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights (EFP), deren Ergebnisse das Netzwerk im Europaatlas Cervical Cancer Prevention Atlas festhält[1]. Am heutigen Weltkrebstag möchten wir die Kernaussagen der Studie vorstellen, um erneut für das Thema zu sensibilisieren.
In Europa erhalten jedes Jahr über 60.000 Frauen die Diagnose Gebärmutterhalskrebs. Mehr als 25.000 Betroffene sterben jährlich an der Krankheit. Damit ist die Krebsart zwar „nur“ die neunthäufigste Krebserkrankung bei Frauen in Europa insgesamt, aber die zweithäufigste Krebstodesursache bei Frauen im Alter von 15 bis 44 Jahren. Die Zahlen erschrecken. Jedoch zeigt die EFP-Erhebung, dass es bereits funktionierende Vorsorgesysteme gibt.
So zum Beispiel in Dänemark. Das Land hat als eines der ersten die HPV-Impfung eingeführt[2]. Um die Vorteile der Impfung bekannt werden zu lassen, führte die Regierung 2016 eine großflächige Kampagne unter dem Motto „Stop HPV, Stop Cervical Cancer“ durch. Gesundheitsexperten klärten dabei Eltern über die Chancen und Risiken der Impfung auf. In Folge der Kampagne stieg die Anzahl der geimpften Mädchen signifikant an, wodurch sich die Zahl der Infizierten vermindert(e). Heute werden auch Jungen in Dänemark kostenlos geimpft. Weiterhin verfügt das vergleichsweise kleine Land über ein ausgereiftes Screening-Programm für Erwachsene.
Klare Unterschiede in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge
Insgesamt bewertet die Studie die Vorsorgemaßnahmen von 46 europäischen Ländern. Das Engagement im Kampf gegen die Krankheit unterscheidet sich deutlich:
Deutschland erreicht im Bereich der Impf-Vorsorge und Aufklärungsarbeit die volle Punktzahl. Abzug wird in Hinblick auf das nationale Screening-Programm erteilt, was zu einem Gesamtranking auf Platz 12 von 46 führt. Hier gibt es entsprechend noch einiges zu tun. Ein erster Schritt sind die Anschreiben, die Frauen ab 20 Jahren seit Anfang 2020 aktiv zum Krebsfrüherkennungsprogramm für Gebärmutterhalskrebs einladen. Darüber hinaus sind Abstrich-Selbstentnahme Kits für zu Hause eine vielversprechende Option. In den Niederlanden werden diese bereits angeboten.
Lokale Unterschiede werden im Cervical Cancer Prevention Atlas ebenfalls erkennbar. Den Farben des Ampelsystems folgend, sind die gut abschneidenden Länder in Nord- und Zentraleuropa grün dargestellt. Je weiter man sich auf der Karte Richtung Osten und Süden bewegt, desto mehr Rottöne treffen den Blick. Laut der Studie verfügen acht europäische Länder über gar keine staatlichen Regeln zu Präventionsmaßnahmen.
Deutschland hat Vorbildfunktion
„Erneut zeigt sich, dass für Themen der Frauengesundheit nicht genug Aufmerksamkeit geschaffen werden kann. Deutschland sollte sich hier seiner Vorbildfunktion bewusst werden. Gleichzeitig gilt es, unsere Nachbarn nicht aus dem Blick zu verlieren, sondern solidarisch gegen Gebärmutterhalskrebserkrankungen vorzugehen“, so unsere Geschäftsführerin Dr. Martina Schmitz.
Erst kürzlich betonte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus auf der Jahrestagung der Weltgesundheitsorganisation die Bedeutung der HPV-Impfung in Hinblick auf die hohen Todeszahlen, die jährlich auf die Krankheit zurückzuführen sind.
Titelbild: Cervical Cancer Prevention Policy Atlas (© European Parliamentary Forum for Sexual & Reproductive Rights)
[1] www.epfweb.org/node/553
[2] www.epfweb.org/sites/default/files/2020-05/hpv_and_cervical_cancer.pdf, S. 10
Symptome Gebärmutterhalskrebs: Vorsorge ist lebensrettend
BlogDer regelmäßige Vorsorgetermin beim Frauenarzt sollte eigentlich Standard für jede Frau sein. Ernsthafte Erkrankungen wie Gebärmutterhalskrebs werden so frühzeitig erkannt und in vielen Fällen auch geheilt. Treten zwischenzeitlich trotzdem Beschwerden auf, sollten die betroffenen Frauen diese unbedingt abklären. Meist sind harmlose Infektionen die Ursache. Einige Symptome können jedoch auch auf Gebärmutterhalskrebs hindeuten.
Gebärmutterhalskrebs: Definition und Ursache
Die Gebärmutter besteht aus dem Gebärmutterkörper und am unteren Ende dem Gebärmutterhals, der in die Scheide mündet. Zellveränderungen, bzw. ein bösartiger Tumor am Gebärmutterhals, wird als Gebärmutterhalskrebs oder Zervixkarzinom bezeichnet.
Für die Entstehung von Gebärmutterhalskrebs ist eine Infektion mit Humanen Papillomviren (HPV) verantwortlich. Nahezu jede Frau infiziert sich einmal in ihrem Leben auf sexuellem Weg mit dem Virus. In den meisten Fällen heilt die HPV-Infektion jedoch von alleine wieder aus. Die meisten Frauen bemerken von ihrer Erkrankung nichts, da sie ohne Symptome verläuft. In weniger als einer von 100 Fällen bleibt die HPV-Infektion jedoch über Jahre bestehen und entwickelt sich zu Gebärmutterhalskrebs.
Symptome Gebärmutterhalskrebs:
Da Gebärmutterhalskrebs über einen sehr langen Zeitraum und über Krebsvorstufen entsteht, verursacht er zu Beginn auch keine Symptome. Entsprechend treten Beschwerden meist erst auf, wenn tatsächlich Krebs entstanden ist. Wer diese Symptome bei sich bemerkt, sollte unbedingt seinen Frauenarzt aufsuchen:
Welche Untersuchungen auf Gebärmutterhalskrebs gibt es?
Beim Frauenarzt wird der Gynäkologe wahrscheinlich erstmal einen Pap-Abstrich vornehmen. Die daraus gewonnene Probe wird unter dem Mikroskop auf Zellveränderungen untersucht. Außerdem liefert ein HPV-Test weitere Hinweise auf eine Gebärmutterhalskrebserkrankung. Beide Tests sind übrigens seit Anfang 2020 Teil des Neuen Programms zur Gebärmutterhalskrebsvorsorge. An der regelmäßigen Krebsvorsorge sollte jede Frau, unabhängig von vorliegenden Beschwerden, teilnehmen. Sowohl ein auffälliger Pap-Abstrich als auch ein positiver HPV-Test liefern jedoch noch keinen gesicherten Hinweis auf eine Krebserkrankung.
Zudem entsteht Gebärmutterhalskrebs über mehrere Jahre. Zellveränderungen oder eine HPV-Infektion können von allein ausheilen. Um das zu kontrollieren, wird der Frauenarzt gegebenenfalls die betroffene Frau nach einem bestimmten Zeitraum zur Wiederholung des Pap-Abstrichs und/oder des HPV-Tests einbestellen.
Möglicherweise sind auch weitere Untersuchungen notwendig, wie beispielsweise eine Kolposkopie mit Biopsie. Dabei wird, ganz vereinfacht gesagt, das Gewebe des Gebärmutterhalses unter einem speziellen Mikroskop angeschaut. Eine weitere Möglichkeit, die zur Diagnose von Gebärmutterhalskrebs hinzugezogen werden kann, ist ein molekularbiologischer Test, der die DNA der betroffenen Zellen auf krebstypische Veränderungen untersucht. Welche Methode die geeignete ist, bespricht die betroffene Frau mit ihrem Frauenarzt.
Wir von der oncgnostics GmbH forschen und entwickeln Krebstests auf molekularbiologischer Basis. Eines unserer Produkte ist GynTect, ein Test auf Gebärmutterhalskrebs. Er ist in der Lage, Gebärmutterhalskrebs bereits in seinen Vorstufen zu erkennen. Für seine Durchführung ist ein gynäkologischer Abstrich beim Frauenarzt ausreichend.
Fragen Sie die Ärztin oder den Arzt Ihres Vertrauens
Die hier dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Der Text erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch garantiert er die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Informationen. Er ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer den Arzt oder die Ärztin Ihres Vertrauens!
Titelbild: Duda Vasilii/Shutterstock.com
Lachsterrine – Weihnachtszeit mit Schluckstörung
BlogEin festliches Essen gehört zur Weihnachtszeit einfach dazu – für Menschen mit Schluckstörung, bspw. durch einen Kopf-Hals-Tumor ausgelöst, kann das Festmahl mit der Familie zur Herausforderung werden. Foodbloggerin Claudia Braunstein kennt die Situation aus eigener Erfahrung und entwickelt köstliche Rezepte, die Menschen mit Schluckstörung genießen können. Für dieses Weihnachten schlägt die Österreicherin eine festliche Lachsterrine vor:
Liebe Leserinnen und Leser,
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Ein ganz und gar ungewöhnliches Jahr. Auch wenn der Dezember noch mit Einschränkungen aufwarten wird und heuer wahrscheinlich traditionelle Familienfeiern oder große Silvester Partys eher nicht stattfinden werden, so kann man auch im kleinen Rahmen die Feiertage mit lieben Menschen verbringen. Gutes Essen gehört da unweigerlich dazu. Natürlich wünschen sich auch Dysphagie Patienten besondere Gerichte. Terrinen sind da der richtige Tipp. Die Lachsterrine mutet fast ein wenig nostalgisch an, aber sie ist gerade für Menschen mit Schluckstörungen sehr gut geeignet. Lachsterrine kann man hübsch anrichten, ich mag auch gerne Lachskaviar dazu, auch Sahnemeerrettich passt gut. Die Terrine kann man ohne große Abänderung auch jedem Normalesser servieren.
Rezept: Lachsterrine für festliche Anlässe
Lachs in grobe Würfel schneiden. Fischfond mit 250 ml Wasser auffüllen und erhitzen. Anschließend den Lachs im Fond ca. 10 Minuten pochieren. Danach den Lachs aus dem Fond heben und mit Limettensaft und gehackter Dille fein pürieren. Schlagobers langsam hinzufügen und Crème fraîche unterrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Gelatine im kalten Wasser einweichen, ausdrücken, in etwas Wasser kurz erwärmen und unter die Masse rühren. Form mit Klarsichtfolie auslegen und die Masse einfüllen. Über Nacht im Kühlschrank kaltstellen.
Ihre Claudia Braunstein!
Foto: Claudia Braunstein
————————————————————–
Wir von der oncgnostics GmbH forschen an der Diagnostik von unterschiedlichen Krebsarten, so auch im Bereich der Kopf-Hals-Tumoren. Mit Betroffenen, wie Claudia Braunstein im Austausch zu stehen ist uns ein wichtiges Anliegen. So lernen wir die Besonderheiten und Bedürfnisse der Menschen kennen.
Alle Gast-Rezepte von Claudia Braunstein finden Sie hier.
Impfung gegen HPV: Hilfe gegen verschiedene Krebsarten
BlogDie Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht in einer weltweit verstärkten Impfung gegen HPV-Infektionen eine große Chance im Kampf gegen verschiedene Krebsarten. Auf der Jahrestagung der Organisation erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus, den HPV Impfstoff breiter einsetzen zu wollen. So soll vor allem gegen die global zunehmenden Fälle von Gebärmutterhalskrebs vorgegangen werden. Mit zusätzlichen Behandlungen und neuen Tests könnten bis zum Jahr 2050 fünf Millionen Todesfälle umgangen und somit viele Leben gerettet werden, so Ghebreyesus1.
Was steckt hinter der WHO-Strategie? Im Folgenden betrachten wir genauer, welche Gefahren von Humanen Papillomaviren (HPV) ausgehen und besprechen die Chancen, die das Impfen gegen HPV bietet.
Was passiert bei einer HPV-Infektion?
Die HPV Übertragungswege sind vor allem sexueller Art. Tatsächlich infizieren sich die meisten sexuell aktiven Menschen mindestens einmal im Leben mit dem Virus2. Dabei verlaufen die meisten HPV-Infektionen jedoch ohne erkennbare Symptome. Sie heilen von allein aus. Bereits nach ein bis zwei Jahren sind sie nicht mehr nachweisbar.
Unabhängig von dem unauffälligen Verlauf unterscheidet man zwischen Niedrigrisiko-Typen und Hochrisiko-Typen. Erstere sind z. B. für Genitalwarzen verantwortlich, die einer ärztlichen Behandlung bedürfen. Wenn eine Infektion mit Hochrisiko-HPV-Typen nicht von selbst ausheilt, kann sie sich über verschiedene Vorstufen zu Krebs entwickeln. Dies dauert im Schnitt 10 bis 15 Jahre3.
Laut des Zentrums für Krebsregisterdaten erkranken in Deutschland jährlich etwa 6.250 Frauen und ca. 1.600 Männer an HPV-bedingten Krebsarten4.
Zu den Krebsarten, die durch HPV verursacht werden, zählen:
Vor welchen Krankheiten schützt die Impfung gegen HPV?
Seit einigen Jahren gibt es Impfstoffe gegen die wichtigsten Hochrisiko-HPV-Typen5. In Europa und den USA wird der HPV-Impfstoff seit 2006 eingesetzt. 2020 verdeutlichte eine erste Studie aus Schweden Erfolge beim Impfen gegen Gebärmutterhalskrebs. Frauen, die bis zu ihrem 17. Lebensjahr gegen HPV geimpft wurden, hatten laut Studienergebnis ein um 88 Prozent geringeres Risiko für Gebärmutterhalskrebs, als ungeimpfte Frauen6.
Der Impfstoff wird zudem als vorbeugende Maßnahme für Kopf-Hals-Tumoren eingesetzt. Anna-Bawany Hums ist als Molekularbiologin in der Abteilung für Forschung und Entwicklung bei der oncgnostics GmbH tätig: „Kopf-Hals-Tumoren die auf HPV zurückzuführen sind, entwickeln sich über noch längere Zeiträume als Gebärmutterhalskrebs. Daher gibt es bisher keine Studien, die die Effekte von HPV-Impfungen für diese Krebsarten belegen6. Umso wichtiger ist es, gleichzeitig die Diagnose für diese Krankheit zu verbessern. Wir von der oncgnostics GmbH erforschen, wie man Kopf-Hals-Tumoren schon in frühen Stadien mit nicht-invasiven Diagnoseverfahren erkennen kann. So wollen wir die Chance auf einen Therapieerfolg erhöhen. Je früher eine Krebserkrankung erkannt wird, desto besser sind die Aussichten auf Heilung für Betroffene“.
Wer sollte geimpft werden?
Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt, dass Eltern ihre Kinder, also sowohl Jungen als auch Mädchen, im Alter von 9 bis 14 Jahren gegen HPV impfen lassen. Das junge Alter, in dem man die Kinder impfen lässt, begründet sich unter anderem so:
Egal ob man geimpft ist oder nicht: Vorsorge ist zentral
HPV-induzierte Krebserkrankungen entstehen über viele Jahre und Vorstufen hinweg. Auch nach erfolgter HPV-Impfung bleibt ein Restrisiko bestehen. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind deshalb elementar. In Deutschland gilt seit 2020 ein neues Früherkennungsprogramm für Gebärmutterhalskrebs. Das Programm sieht unter anderem eine Co-Testung aus einem Pap- und HPV-Test für Frauen ab 35 Jahren vor.
Auf ihrer Jahrestagung forderte die WHO von den 194 Mitgliedsländern, dass mindestens 70 Prozent der Frauen bis zu ihrem 35. Lebensjahr auf Gebärmutterhalskrebs getestet werden. Zudem sollen bis 2030 mindestens 90 Prozent der Mädchen vollständig gegen HPV geimpft sein, bevor sie 15 Jahre alt werden.
Systematische Vorsorgeuntersuchungen für Kopf-Hals-Tumoren gibt es in Deutschland bisher nicht. Hier gilt es, auftretende Beschwerden im Mund- und Rachenbereich frühzeitig ärztlich abklären zu lassen.
Fragen Sie die Ärztin oder den Arzt Ihres Vertrauens
Die hier dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen oder Arzneimittel dar. Der Text erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch garantiert er die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Informationen. Er ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer den Arzt oder die Ärztin Ihres Vertrauens!
Quellen
[1] WHO stellt Strategie zur Bekämpfung von Gebärmutterhalskrebs vor. In: Ärzteblatt, 17. November 2020. Online verfügbar: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/118411/WHO-stellt-Strategie-zur-Bekaempfung-von-Gebaermutterhalskrebs-vor
[2] Robert Koch Institut (2020): HPV (Humane Papillomviren): Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Erreger und Impfung. Online verfügbar: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Impfen/HPV/FAQ-Liste_HPV_Impfen.html;jsessionid=3F10B057E8CD109E0C8EF04167FB32E6.internet072?nn=2375548
[3] Bundesgesundheitsministerium (2020): Verbesserte Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs seit Januar 2020. Online verfügbar: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/frueherkennung-vorsorge/frueherkennung-von-gebaermutterhalskrebs.html
[4] Robert Koch Institut (2018): RKI-Ratgeber. Humane Papillomviren. Online verfügbar: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_HPV.html
[5] Krebsinformationsdienst: Humane Papillomviren und Krebs. Online verfügbar: https://www.krebsinformationsdienst.de/vorbeugung/risiken/hpv.php
[6] Robert Koch Institut (2020): HPV (Humane Papillomviren): Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Erreger und Impfung. Online verfügbar: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Impfen/HPV/FAQ-Liste_HPV_Impfen.html;jsessionid=3F10B057E8CD109E0C8EF04167FB32E6.internet072?nn=2375548
Titelfoto: LookerStudio/www.shutterstock.com