https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/08/Infografiken_DE_200805_Blog-3.png
321
846
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-08-06 14:11:282020-08-06 14:11:33Psychische Belastung in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/08/Sterz-mit-Häferlkaffee-Polenta-mit-Kaffee_web.jpg
321
845
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-08-03 10:04:172020-08-05 07:56:10Polentabrei mit Kaffee oder Steirischer Sterz mit Häferlkaffee
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/07/shutterstock_1701837643_blog.jpg
321
846
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-07-29 11:54:292020-07-31 09:00:08Geschäftsreisen in Corona-Zeiten
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/06/Dessert-mit-Johannisbeeren_blog-scaled.jpg
972
2560
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-07-08 08:03:332020-07-01 14:23:42Genießen trotz Schluckstörung: Johannisbeer-Traumschaum
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/07/shutterstock_507639565_slider.jpg
630
1500
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-07-06 08:00:342020-12-16 09:14:27Dysphagiekost genussvoll zubereiten
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/06/Grafik_Blog_Kehlkopfkrebs2.jpg
319
845
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-06-16 12:02:272020-06-18 16:20:21Husten, Kratzen, Kehlkopfkrebs: Symptome erkennen und Ursachen vermeiden
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/05/Shutterstock_514771963_blog.jpg
674
1760
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-05-19 13:36:262020-08-28 14:11:33Mit dem Rauchen aufhören lohnt sich!
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/04/shutterstock_181677836_blog-1.jpg
563
845
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-05-12 09:01:232021-02-09 09:31:17George Nicholas Papanicolaou und der Pap-Test
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/04/20190328_110817_b.jpg
1740
2319
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-04-21 14:18:032020-06-29 12:17:15Wir öffnen unser Labor: Durchführung von GynTect
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2020/04/Screenshot2.png
768
1366
Ines Sommer
https://www.oncgnostics.com/wp-content/uploads/2015/03/oncgnostics-logo1-300x138.png
Ines Sommer2020-04-08 14:39:482020-04-14 10:19:09Frohe Ostern aus dem Homeoffice!
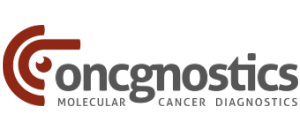
Psychische Belastung in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge
PressemeldungKontrolliertes Zuwarten ist eines der häufigsten Mittel, um Auffälligkeiten in der Gebärmutterhalskrebsfrüherkennung abzuklären. Dabei werden HPV-Test oder Pap-Abstrich nach einem bestimmten Zeitraum wiederholt. Für viele Frauen bedeutet dieses Vorgehen eine unklare Situation. Eine neue Studie zeigt die psychische Belastung in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge auf. Die Ergebnisse der wissenschaftlich gestützten Befragung wurden nun in der Fachzeitschrift Archives of Gynecology and Obstetrics, des Springer Medizinverlags veröffentlicht.
Die Kernaussagen der Studie zeigen psychische Belastung auf:
Statement: Psychische Belastung in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge muss Beachtung finden
Co-Autoren der Studie sind oncgnostics-Geschäftsführer Dr. Alfred Hansel und Dr. Martina Schmitz. Die Biochemikerin zieht aus den Ergebnissen der Studie deutliche Schlüsse: „Die Untersuchungsmethoden zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs haben ihre Grenzen. Eine Auffälligkeit beim Pap-Abstrich bedeutet genauso wenig automatisch eine Krebserkrankung wie eine Infektion mit humanen Papillomviren. Denn sowohl die Gewebeauffälligkeiten, die im Pap-Abstrich zu erkennen sind, als auch die Infektion mit HPV heilen meist von selbst. Daher warten die Ärzte bei entsprechendem Befund ab, ob dieser bei der nächsten Untersuchung noch immer vorliegt. Die psychische Belastung, die dieses Abwarten bis zum nächsten Termin bei den betroffenen Frauen erzeugt, belegt die nun veröffentlichte Studie. Zwei Schlüsse lassen sich daraus besonders ziehen: (1) es bedarf viel mehr Aufklärung, was auffällige Befunde bzw ein positiver HPV-Test wirklich bedeuten; (2) wir brauchen eine wesentlich bessere, genauere Diagnostik, um diese psychische Belastung durch unklare Befunde erst gar nicht entstehen zu lassen.“
Digitale Pressekonferenz
Vorstellung der Studie zur psychischen Belastung in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge
06.08.2020
Pressemappe
Polentabrei mit Kaffee oder Steirischer Sterz mit Häferlkaffee
BlogGastbeitrag von Claudia Braunstein:
Jeden Monat verrät uns die Salzburger Bloggerin Claudia Braunstein regelmäßig köstliche Rezepte für Menschen mit Schluckstörungen. Heute steht eine österreichische Spezialität auf der Speisekarte: „Steirischer Sterz mit Häferlkaffee“, was so viel bedeutet wie „Polentabrei mit Kaffee“.
Hallo liebe Leserinnen und Leser,
vermutlich kennen die wenigsten Leser den Begriff Sterz für Polenta, den gelben Maisgrieß. Sterz mit Häferlkaffee hat mich durch meine Kindheit und Jugend begleitet, denn dieses Gericht stammt aus der steirischen Heimat meiner geliebten Omi. Sterz gab es bei uns meist als Abendessen, er kann aber genauso gut als Frühstück zubereitet werden. Wir Kinder bekamen damals den typischen Malzkaffee. Wenn ich mir heute diese Speise zubereite, dann darf es ruhig auch ein Cappuccino sein.
Überhaupt ist Polentabrei für Dysphagie-Patienten, die nicht unbedingt flüssig oder dickbreiig essen müssen, ein ideales Gericht und man kann es sehr variantenreich gestalten. Lässt man Zucker oder Honig als Süßungsmittel weg, dann kann man dazu deftigere Beilagen servieren. Ich mag sehr gerne ein feines Ratatouille dazu, das sollte dann aber gut gekocht sein, damit es keine festen Stücke mehr beinhaltet. Je nach Schluckstörung kann man das Gemüse immer noch pürieren.
Aber nun zurück zum Steirischen Sterz, den man übrigens auch in Kärnten unter diesem Namen findet. Wer nun noch fragt, was ein Häferl ist, dem erkläre ich das gerne. Häferl oder auch Haferl ist ein Becher oder eine große Tasse, aus dem man bei uns Milchkaffee trinkt.
Polentabrei mit Kaffee
für 2 Portionen
Wasser mit etwas Salz in einem Topf aufkochen. Polenta einrühren und rund 15 Minuten leicht köcheln. Sollte die Masse zu dick sein, kann man noch Wasser hinzufügen, bis die passende Konsistenz erreicht ist. Von der Herdplatte nehmen und für zirka 10 Minuten ausdampfen lassen. Butter und Honig einrühren und auf zwei Suppenteller oder kleine Schüsseln verteilen. Kaffee dazu genießen oder auch über die Polenta gießen.
Guten Appetit wünscht Claudia Braunstein!
Alle Gast-Rezepte von Claudia Braunstein finden Sie hier.
Geschäftsreisen in Corona-Zeiten
BlogGeschäftsreisen in Corona-Zeiten sind unmöglich? Das fürchteten wir zu Beginn des Jahres auch. Doch dann reisten wir beispielsweise nach Kuwait oder Barcelona: Die neue Art zu Reisen ist digital.
Digitale Geschäftsreise in die VAE
Im Juni erkundete oncgnostics Geschäftsführer Dr. Alfred Hansel mit einer Geschäftsanbahnungsreise in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Kuwait den dortigen Markt. Die digitale Version der Veranstaltung ersetzte eine Geschäftsanbahnungsreise, die von der trAIDe GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) organisiert wurde. „Die wichtigen Vorträge und Gespräche funktionierten auch online sehr gut“, fasst Dr. Alfred Hansel seine Reise zusammen und ergänzt: „Natürlich konnte ich am PC nicht das Land und die Kultur kennenlernen, doch einige vielversprechende Gespräche ließen sich auch digital anbahnen und führen. Es war eine sehr gute Möglichkeit, Geschäftsreisen in Corona-Zeiten zu realisieren.“
Digitaler Pitch auf den Thüringer Investor Days
Selbst eine kleine Fahrt in die Nachbarstadt zu den Thüringer Investor Days war im Juni noch nicht möglich. Doch die Veranstalter, die Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen (STIFT) sowie die bm-t beteiligungsmanagement thüringen gmbh, reagierten schnell mit einer digitalen Version der Veranstaltung. So konnte Dr. Peter Haug für die oncgnostics GmbH beim Format „Meet the Rising Stars“ pitchen. „Ich fand es beeindruckend, wie schnell die Veranstalter reagiert und eine digitale Lösung gefunden haben. Am Anfang war es für mich noch ungewohnt, zu pitchen, ohne dem Publikum in die Augen sehen zu können, aber man gewöhnt sich an das neue Format. Alles in allem möchte ich mich bedanken, dass mit Hilfe einer digitalen Version nicht auf die Thüringer Investor Days verzichtet werden musste.
Geschäftsreisen in Corona-Zeiten auch nach Spanien
Ende Juli reiste oncgnostics Geschäftsführerin Dr. Martina Schmitz per Rechner zur 33. International Papillomavirus Conference (IPVC). Diese sollte in diesem Jahr eigentlich bereits im März in Barcelona stattfinden und wurde zunächst aufgrund der aktuellen Lage verschoben – und nun komplett digital abgehalten. „So eine digitale Konferenz hat Vor- und Nachteile. Viele Beiträge der Konferenz standen in der Woche zeitunabhängig zur Verfügung. So konnte ich mir frei einteilen, wann ich mir was anschaue. Zu bestimmten Diskussionsrunden gab es dann feste Termine. Ich finde es gut, dass die Veranstalter eine digitale Lösung gefunden haben. Für mich persönlich ersetzt allerdings eine digitale Konferenz den menschlichen Kontakt nicht komplett“, fasst Dr. Martina Schmitz ihre digitale Reise zusammen.
Titelbild: Vadim Georgiev/Shutterstock.com
Genießen trotz Schluckstörung: Johannisbeer-Traumschaum
BlogGastbeitrag von Claudia Braunstein:
Hallo liebe Leserin, lieber Leser,
Ich bin Claudia Braunstein aus Salzburg und schreibe seit gut acht Jahren einen Food Blog. Nicht irgendeinen, sondern einen Blog mit Rezepten, Infos und Tipps für Menschen mit Kau- und Schluckstörungen. Ich selbst bin von Dysphagie, so der Fachausdruck, betroffen, weil ich im Sommer 2011 an einem seltenen Karzinom am Zungenrand, übergehend in den Mundboden erkrankt bin. Zum Glück konnte ich diese schreckliche Krankheit hinter mir lassen. Allerdings erinnern mich täglich zahlreiche Einschränkungen an diese Diagnose. Vor allem die Störungen des Schluckaktes prägen meinen Alltag. Ich kann nicht einfach in ein Restaurant gehen, weil es kaum Speisen für mich gibt. Obwohl ein nicht unbeträchtlicher Teil der Bevölkerung an einer Form von Dysphagie leidet, wird dieses Thema in der Gesellschaft verschwiegen und tabuisiert.
Essen mit Dysphagie
Trotzdem gehe ich laufend auswärts essen. Das bedeutet eine gute Vorbereitung und auch ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein, denn nicht jeder kann diese Problematik nachvollziehen. Mein Tipp ist vorab Menükarten im Internet zu studieren und eventuell schon im Vorfeld das gewünschte Lokal per E-Mail zu kontaktieren. Das funktioniert wunderbar.
Zuhause habe ich meine Einschränkung gut im Griff. Ich gestalte Speisen so, dass auch Normalesser eine Freude haben. Ganz selten koche ich für mich extra, meist benötigt es nur ein paar Handgriffe und Speisen für Familie und Gäste sind auch dysphagie-tauglich.
Heute habe ich ein super einfaches Rezept mitgebracht. Normalerweise ist Dysphagiekost nicht sonderlich attraktiv. Dabei lautet der Trick, die Speisen in schönem Geschirr zu servieren, den Tisch auch im Alltag schön zu decken und das Gericht mit Kräutern, Obst- oder Gemüsestückchen, oder auch Salatblättern zu dekorieren. Das isst man dann einfach nicht mit. Dafür freut sich das Auge.
Rezept: Johannisbeer-Traumschaum
Jetzt im Juli ist Saison für Johannisbeeren, die bei uns in Österreich übrigens Ribisel heißen. Zusammen mit Schlagsahne kann man blitzschnell ein Dessert herrichten.
Johannisbeer-Traumschaum: 2 Portionen
Johannisbeeren vom Zweig entfernen und mit den Blättchen der Zitronenmelisse fein pürieren. Zitronenspritzer zufügen. Durch ein Sieb streichen. Zusammen mit der Sahne fest schlagen. Das funktioniert auch gut mit einem Sahnespender. Johannisbeer-Schaum in Gläser füllen, mit Beeren und Blättchen garnieren. Fertig ist der Traum.
Auf unserem Blog verrät uns Claudia regelmäßig neue Rezepte für Menschen mit Schluckbeschwerden.
Dysphagiekost genussvoll zubereiten
BlogFür Menschen mit einer Schluckstörung ist jede Mahlzeit eine Herausforderung. Beißen, Kauen und Schlucken – mit einer sogenannten Dysphagie ist das keine Selbstverständlichkeit. Freude am Essen sieht anders aus. Hier verrät demnächst die Bloggerin Claudia Braunstein, wie Dysphagiekost genussvoll geht.
Schluckstörungen können sehr individuell sein. Was für den einen funktioniert, bleibt dem anderen möglicherweise im Halse stecken. Es gilt also, sich selbst und seine Besonderheiten kennen zu lernen: Ob beispielsweise Erdbeeren als kleine Stücke oder besser als Püree dem Gaumen schmeicheln, muss jeder für sich selbst herausfinden. Möglicherweise müssen die roten Früchte auch passiert werden.
Dysphagie als Folge einer Krebserkrankung
In vielen Fällen können Schluckstörungen, auch Dysphagien genannt, als Begleiterscheinung eines Tumors im Kopf-Hals-Bereich wie zum Beispiel Zungenkrebs oder Kehlkopfkrebs auftreten. Aber auch neurologische Erkrankungen können dazu führen, dass der komplexe Vorgang gestört wird. Der Schluckakt ist gestört und Nahrung sowie Flüssigkeiten können nicht mehr richtig zum Magen transportiert werden. Die Kraft beim Beißen und Kauen kann nachlassen, Speichel unkontrolliert fließen. Das Essen bleibt den Betroffenen dann im wahrsten Sinne des Wortes im Halse stecken oder gerät sogar in die Luftröhre. Das Frühstück wird zu einem langwierigen Prozess und das Mittagessen der tägliche Mount Everest. Ein nettes Abendessen mit Freunden scheint plötzlich wie ein Albtraum. Niemand möchte im Restaurant mit scheinbar schlechten Tischmanieren auffallen und zu Hause zu kochen scheint oft auch keine Lösung. Denn Dysphagiekost klingt weder schmackhaft noch optisch ansprechend.
Dysphagiekost: Kochen aus Leidenschaft
Foodbloggerin Claudia Braunstein
Dysphagiekost geht lecker, genussvoll und schick! Das beweist die Bloggerin Claudia Braunstein regelmäßig mit ihren Posts. Suppen oder sogar gefüllte Paprika sind dort so köstlich angerichtet, dass sie sich von „normalen“ Speisen nicht unterscheiden. Nach ihrer Zungenkrebserkrankung wollte sich die Österreicherin nicht damit abfinden, dass jede Mahlzeit nur noch ein notwendiges Übel ist. Sie eroberte sich den Genuss beim Essen trotz Schluckstörung zurück. Dabei entdeckte Claudia Braunstein ihre Leidenschaft fürs Kochen neu. Sie experimentierte in der Küche und entwickelte eigene Rezepte. Schließlich veröffentlichte sie sogar Kochbücher über Dysphagiekost. In den nächsten Wochen wird uns Claudia Braunstein einige ihrer Rezepte verraten.
Schluckstörung: Rezepte zum Genießen
———————————————————-
Portrait: R.E.S Photo
Titelbild: Rawpixel.com/Shutterstock.com
Husten, Kratzen, Kehlkopfkrebs: Symptome erkennen und Ursachen vermeiden
BlogBösartige Tumoren in den oberen Luft- und Speisewegen stellen weltweit die sechsthäufigste aller Krebsarten dar[1]. Im Jahr 2014 wurden allein in Deutschland etwa 2.980 Männer und rund 520 Frauen diagnostiziert, die an Kehlkopfkrebs erkrankt waren[2].
Tückisch an dieser Krebserkrankung sind die uneindeutigen Symptome. Vermeidbar hingegen sind die häufigsten Ursachen. Wir wollen für beide Aspekte sensibilisieren.
Symptome für Kehlkopfkrebs
Dass die Krankheit häufig erst spät bemerkt wird, liegt vor allem daran, dass erste Anzeichen von Kehlkopfkrebs nicht eindeutig zuzuordnen sind. Das erschwert die Diagnose enorm. Ein Grund dafür ist, dass die in der Regel schnell wachsenden Geschwüre individuell an verschiedenen Stellen des Kehlkopfes ansetzen. Entsprechend unterschiedlich sind die ausgelösten Beschwerden.
Typische Frühwarnzeichen bei Kehlkopfkrebs sind[3]
Treten diese Tumor-Symptome über einen Zeitraum von drei Wochen auf, sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Häufigste Ursachen für Kehlkopfkrebs
Das größte Risiko an Kehlkopfkrebs zu erkranken, tragen Raucher. Laut der Deutschen Krebsgesellschaft gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlichkeit für den Ausbruch der Krankheit und der Dauer und Intensivität des eigenen Tabakkonsums. Durch zusätzliches Trinken von Alkohol wird das Auftreten bestimmter Kehlkopfkrebsarten wahrscheinlicher.
Des Weiteren kann eine Infektion mit Humanen Papillomaviren (HPV) zu Krebs im Rachenbereich und somit auch am Kehlkopf führen.
Vorsorgeuntersuchung und Heilungschancen
Bislang sind aufwändige Untersuchungen für eine Diagnose notwendig, da die Region schwer zugänglich ist. Dazu zählen beispielsweise:
Diese Verfahren greifen generell erst bei einem Verdachtsfall. Ein organsiertes Screening der Bevölkerung und insbesondere der Risikogruppen fehlt bisher. Ein Forschungsanliegen der oncgnostics GmbH ist es daher, einen nicht-invasiven Test zur Früherkennung für Kopf-Hals-Tumoren zu entwickeln. Krebszellen sollen hierbei bereits in Speichelproben nachgewiesen werden. So sollen oben genannte Beschwerden zukünftig unkompliziert auf Krebs abgeklärt werden können.
Inwiefern eine Tumorerkrankung am Kehlkopf geheilt werden kann, hängt maßgeblich vom Alter und dem allgemeinen Gesundheitszustand der betroffenen Person ab. Je früher die Erkrankung festgestellt wird, desto höhere Chancen auf eine vollständige Heilung bestehen. In einer regelmäßigen und langfristigen Nachsorge wird später kontrolliert, ob der Krebs zurückkommt oder innerhalb des Körpers streut.
Quelle:
ONKO-Internetportal unter krebsgesellschaft.de
[1] https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/krebsarten/andere-krebsarten/kehlkopfkrebs.html
[2] https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/krebsarten/andere-krebsarten/kehlkopfkrebs/definition-und-haeufigkeit.html
[3] https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/krebsarten/andere-krebsarten/kehlkopfkrebs/symptome.html
[4] https://www.krebsgesellschaft.de/onko-internetportal/basis-informationen-krebs/krebsarten/andere-krebsarten/kehlkopfkrebs/ursache-und-risikofaktoren.html
Titelbild: SciePro/Shutterstock.com (bearbeitet)
Mit dem Rauchen aufhören lohnt sich!
BlogAuch langjährige Raucher senken ihr Krebsrisiko, wenn sie mit dem Rauchen aufhören. Die Sucht zu überwinden ist nicht einfach, doch die Aussicht auf gewonnene Lebensjahre kann motivieren. Im besten Fall senken auch späte Tabakabstinenzler ihr erhöhtes Krebsrisiko komplett.
Die meisten Menschen fangen bereits im Jugendalter mit dem Rauchen an. Rauchen gehört zum freien Lebensgefühl, die Gedanken kreisen um das Hier und Jetzt, unmerklich wandelt sich das gelegentliche „Mal-Ziehen“ in eine Sucht. Plötzliche ist der Raucher oder die Raucherin 30 Jahre alt und kann auf eine mehr als zehnjährige Tabakkariere zurückblicken. Der naheliegende Gedanke: Nun lohnt sich das Aufhören auch nicht mehr – ist falsch!!!
Das erhöhte Krebsrisiko lässt sich senken
Wie der Deutsche Krebsinformationsdienst schreibt, können ehemalige Raucher, die mit 30 Jahren mit dem Rauchen aufhören, ihr erhöhtes Krebsrisiko wieder auf ein normales Risiko senken. Dieser Umkehreffekt kann jedoch einige Jahre dauern. Selbst wer erst mit 40 Jahre das Rauchen einstellt, senkt sein erhöhtes Risiko an Krebs zu erkranken.
Tabakkonsum verursacht nicht nur Lungenkrebs
Da Tabak inhaliert wird, verbinden viele dessen Konsum mit der Entstehung von Lungenkrebs. Tatsächlich ist diese nur eine von vielen Krebsarten, die in Verbindung mit dem blauen Dunst steht. Ebenso verursacht Rauchen Speiseröhrenkrebs, Magenkrebs, Darmkrebs, Krebs der Gallenblase und Gallenwege, Leberkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Vulvakarzinom, Blasen- und Harnleiterkrebs oder Nierenkrebs. Dazu ist der Tabakkonsum für fast alle Kopf-Hals-Tumoren verantwortlich. Hierzu zählen Krebs der Mundhöhle, des Mund- und Nasenrachenraums, der Nasenhöhle, der Nasennebenhöhle sowie des Kehlkopfes.
Früh erkannter Krebs rettet Leben
Auch wer früh mit dem Rauchen aufhört oder nie einen Glimmstängel anrührte, sollte regelmäßig zur Krebsvorsorge gehen. Denn grundsätzlich gilt: Je früher Krebs erkannt wird, desto besser ist er behandelbar. In Deutschland gibt es unterschiedliche organisierte Programme zur Krebsfrüherkennung. Diese sind Geschlecht und Alter angepasst und werden von den Krankenkassen übernommen. Allerdings decken die Programme nicht alle Krebsarten ab.
Spät erkannte Tumoren
Insbesondere Tumoren im Kopf-Hals-Bereich werden oft spät erkannt. Die Symptome sind diffus und die Diagnose ist häufig sehr aufwendig. Zudem gibt es noch kein einheitliches und durch die Krankenkassen bezahltes Programm zu Früherkennung von Kopf-Hals-Tumoren. Deswegen forschen wir derzeit an einem Krebstest, der nur anhand einer Speichelprobe erkennt, ob ein Tumor im Kopf-Hals-Bereich vorliegt.
George Nicholas Papanicolaou und der Pap-Test
BlogMit der Entwicklung des Pap-Tests legte der Pathologe George Nicholas Papanicolaou den Grundstein für eine systematische Gebärmutterhalskrebsfrüherkennung. Nach rund 100 Jahren hat sich die Gebärmutterhalskrebsvorsorge weiterentwickelt.
In den 1920ern forschte George Nicholas Papanicolaou intensiv und veröffentlichte dann 1928 seine Ergebnisse zum Papanicolaou-Test, kurz Pap-Test genannt. Der Pap-Test machte eine frühe Untersuchung des Zellgewebes am Gebärmutterhals möglich und damit auch eine frühe Erkennung von Gebärmutterhalskrebs. In Deutschland gibt es eine systematische Gebärmutterhalskrebsfrüherkennung mit Verwendung des Pap-Tests seit 1971. Der Erfolg konnte sich sehen lassen: Die Neuerkrankungs- und Sterblichkeitsrate sank um etwa 60 bis 70 Prozent.
Wie funktioniert der Pap-Test?
Beim Pap-Test werden Gewebeproben unter dem Mikroskop auf Zellveränderungen untersucht. So können Krebsvorstufen oder bereits Gebärmutterhalskrebs früh erkannt werden. Dafür entnimmt der Frauenarzt eine Abstrichprobe vom Gebärmutterhals. Die Ergebnisse des Pap-Tests werden in verschiedene Gruppen Pap I bis Pap V eingeteilt und weisen auf den Schweregrad der Veränderung hin.
Kritik am Pap-Test
Ohne Zweifel stellt die Erfindung des Pap-Tests vor fast 100 Jahren und dessen systematische Einführung vor rund 50 Jahren einen Meilenstein in der Gebärmutterhalskrebsfrüherkennung dar. Doch gibt es auch Kritik am Pap-Test. Denn sein Ergebnis kann falsch negativ sein. Das bedeutet, dass Zellveränderungen übersehen werden. Ebenso kann ein Pap-Test falsch positiv sein. Das bedeutet, dass eigentlich gesunde Frauen einen auffälligen Befund erhalten. Der falsche Alarm ist nicht nur nervenaufreibend für die Patientin, sondern kann auch zu Übertherapien führen.
Pap-Test in der aktuellen Gebärmutterhalskrebsvorsorge
In der aktuellen Gebärmutterhalskrebsvorsorge ist der Pap-Test noch immer nicht wegzudenken. Doch wurde Anfang 2020 ein neues Programm zur Gebärmutterhalskrebsfrüherkennung etabliert. Frauen ab 20 Jahren haben noch immer jährlich Anspruch auf einen Pap-Test, bei Frauen ab 35 Jahren bekommt der Pap-Test dann jedoch Verstärkung durch einen HPV-Test, in Form des Co-Testings. Dieser weist eine Infektion mit Humanen Papillomviren nach, denn bestimmte HPV-Typen können Gebärmutterhalskrebs verursachen. Und auch wir von der oncgnostics GmbH erforschen und entwickeln intensiv neue Möglichkeiten, um Gebärmutterhalskrebs schonend und sicher zur erkennen.
Titelbild: Image Point Fr/Shutterstock.com
Wir öffnen unser Labor: Durchführung von GynTect
BlogNormalerweise spielt sich in einem Labor vieles hinter verschlossenen Türen ab. Strenge Qualitäts- und Hygieneregeln gewähren nur Mitarbeitern Eintritt. Doch anlässlich des Welttages des Labors öffnen wir heute unsere Tür – in Form unseres brandneuen Videos zur Durchführung von GynTect, unseres Tests auf Gebärmutterhalskrebs.
Schritt für Schritt leitet unser Tutorial interessierte Laboranten durch die Abläufe unseres molekularbiologischen Tests GynTect zur Abklärung von Gebärmutterhalskrebs. Endlich können nun auch Gynäkologen sehen, was mit der zervikalen Abstrichprobe passiert, die sie für GynTect zum Labor geschickt haben.
Der Videodreh: ein nachgebautes Labor
Während das Video in wenigen Minuten die wichtigsten Informationen auf den Punkt bringt, war dessen Dreh ein aufwendiges und aufregendes Ereignis für uns. Einen ganzen Tag lang drehte Kameramann Eberhard Schorr – nein, nicht im Labor, sondern an einem separaten Set. Platz- und Lichtverhältnisse wären im Labor nicht ausreichend gewesen.
Applikationsspezialistin vor der Kamera
Normalerweise führt unsere Applikationsspezialistin Kristin Knoll die Arbeitsschritte im Labor routiniert und zügig aus. Für den Video-Dreh galt es aber plötzlich ganz neue Dinge zu beachten: „Für den Dreh hatte ich nur das nötigste Labor-Equipment zur Verfügung und es stand auch nicht alles am gewohnten Platz. Das war notwendig, denn wir haben die Geräte so drapiert, dass sie für die Kamera gut erkennbar sind. Ich musste außerdem die Arbeiten viel langsamer durchführen als gewohnt“, erzählt Kristin Knoll. „Zudem habe ich darauf geachtet, dass meine Finger bei der Arbeit keine wichtigen Details verdecken.“
Laborarbeit aus einem anderen Blickwinkel
Der Videodreh ließ die erfahrene Applikationsspezialistin die Abläufe des GynTect-Tests aus einem anderen Blickwinkel wahrnehmen. Zwar weiß Kristin Knoll wie sie Kunden und interessierten Laboranten die Arbeitsschritte verständlich erklärt, doch beim Videodreh wurden die einzelnen Schritte noch einmal ganz genau unter die Lupe genommen. „Manche Szenen mussten wiederholt werden, damit die Kamera unterschiedliche Perspektiven einnehmen konnte. Da galt es, die einzelnen Arbeitsschritte gut im zu Blick zu behalten.“ Auch musste Kristin Knoll gleichzeitig an die Interessen unserer Kunden, also den zukünftigen Zuschauern des Videos, denken. „Da der Kameramann natürlich die Abläufe im Labor nicht kannte, entschied ich, was besonders wichtig ist und was wir im Video zeigen wollen.“
GynTect-Video ab sofort verfügbar
Das Video zur Durchführung von GynTect soll bestehende Kunden und Partner bei der Laborarbeit unterstützen. Interessierte Laboranten oder Ärzte erhalten durch das Video einen Einblick in unseren molekularbiologischen Test zur Abklärung von Gebärmutterhalskrebs. Wer nur einen schnellen Überblick benötigt, kann sich diesen in rund 50 Sekunden verschaffen. Wer genau wissen will, wie GynTect durchgeführt wird, dem steht unser gut sieben minütiges Tutorial zur Verfügung. Beide Videos sind auch in Englisch (kurz/lang) verfügbar.
Frohe Ostern aus dem Homeoffice!
BlogFrohe Ostern! Wir verabschieden uns aus dem coronabedingten Homeoffice und begrüßen den Osterhasen … nun ja, zu Hause! Die letzten Wochen waren besonders, verrückt und zugleich war es auch toll zu sehen, wie wir alle an einem Strang gezogen haben. Während einige Kolleginnen ins Homeoffice abtauchten, hielt der Rest im Labor und Büro die Stellung – natürlich mit Mindestabstand! Nun freuen wir uns auf ein ebenso besonderes und verrücktes Osterfest mit vielen familiären Videokonferenzen. Wir wünschen schöne Tage und viel Gesundheit!